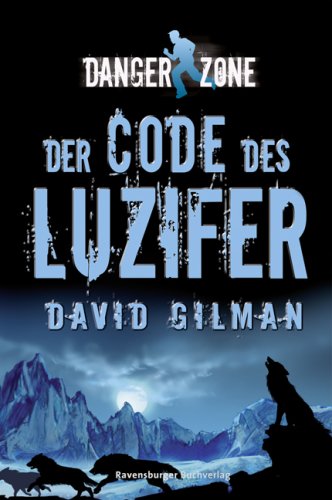![Der Code des Luzifer]()
Der Code des Luzifer
ist nur der Wind«, erklärte Max.
Sayid lächelte gequält und hielt sein Auge wieder an das Teleskop. Max beschloss, ihm noch eine Minute zu lassen. Das Licht, das er eben gesehen hatte, war von der anderen Seite des Raums gekommen.
Er bemerkte einen uralten Spiegel, arg verstaubt, mit grünlich angelaufenem Kupferrahmen, das Glas trüb und braun. Max trat davor und betrachtete sein Spiegelbild. Der Junge, der ihn da anstarrte, hatte keine Augen. Das Licht von oben warf dunkle Schatten auf sein Gesicht und tauchte die Augenhöhlen in Schwarz. Die dünne rote Narbe quer durch seine Augenbraue war noch zu erkennen, und in seiner hochgerutschten Jacke sah er aus, als ob er einen Buckel hätte. Er grinste, und beinahe rechnete er damit, zwischen seinen Lippen Vampirzähne zu erblicken. Um besser sehen zu können, wischte er mit einem Ärmel den Staub von der Glasfläche.
Etwas in dem Spiegelbild machte ihn stutzig.
Er drehte sich um und ging zu der Wand gegenüber. Dort hing ein altes, auf Holz gemaltes Bild. Es war etwa fünfzig Zentimeter hoch und halb so breit. Kleine Ösen aus Messing, ankaum sichtbare Nägel gehakt, hielten es an der Wand. Das Bild, blass und stumpf, hing im dunkelsten Winkel des Raums und passte gar nicht dorthin; und es war das einzige Bild hier überhaupt.
Es wirkte wie eine Malerei aus dem Mittelalter, die dargestellten Figuren flach und zweidimensional und irgendwie unwirklich. Im Hintergrund war eine Gebirgskette zu erkennen; schmutzig graue Gipfel, keine Spur mehr von Schnee. Aber das Bild war leicht zu verstehen. Ein Stern, gelblich weiß, schwebte über den Bergen. Rechts daneben, in gleicher Höhe, war noch ein Stern. Im Vordergrund lag ein Mönch auf der Erde. Sein Kopf ruhte auf einem Baumstamm oder Felsen – es war nicht deutlich zu sehen –, in einer Hand hielt er ein primitives Fernrohr. Er sah uralt aus, geradezu biblisch. Sein zotteliger Bart hing ihm bis auf die Brust und mit dem Zeigefinger seiner freien Hand wies er auf sich selbst.
Max las die französische Inschrift auf dem Messingschildchen, das unten an den Rahmen geschraubt war. Demnach war das Château dem heiligen Antonius, dem Einsiedler, geweiht. Max konzentrierte sich auf jeden einzelnen Pinselstrich. Links unten auf der Holztafel schien ein Kratzer zu sein. Ein Zeichen? Er kippte die Tafel leicht an, damit etwas mehr Licht darauf fiel. Der Kratzer war kaum zu sehen, falls man nicht gerade danach suchte. Es war ein Z.
Das Bild stammte nicht aus dem Mittelalter, nicht einmal vom Beginn des vorigen Jahrhunderts. Max nahm es von der Wand und stellte es auf den Boden; es war erstaunlich schwer. Warum der Mönch durch ein Fernrohr schaute, verstand er nicht, wohl aber, was die beiden Wörter links und rechts neben dem alten Mann bedeuteten: Lux Ferre .
Max sah sich hektisch um, als fürchte er, jemand anderskönnte den Hinweis ebenfalls sehen. Sayid war mit dem Teleskop beschäftigt, im Mondlicht schwebten Staubteilchen umher, sonst bewegte sich nichts. Im Château war es totenstill.
Max kniete sich vor das Bild und starrte dem alten Mann in die Augen. Er war so gemalt, dass der Betrachter das tun konnte – ihm in die Augen sehen –, trotz des Fernrohrs vor seinem Gesicht. Es war, als sehe er Max direkt an.
Einfach Beängstigend.
Der Einsiedler zeigte auf einen winzigen Lichtfleck unter seinem Bart. Noch ein Stern. An seinem Schlüsselbein.
Max berührte den Anhänger, den er um den Hals hängen hatte.
Bobby Morrell war um sein Leben gerannt. Der Sand machte seine Schritte schwer, aber er war stark und trainiert genug, das zu ignorieren. Und die Angst trieb ihn voran, auf das Meer zu, dort wäre er in Sicherheit. Die dunklen Fluten würden ihn aufnehmen, der Neoprenanzug war die perfekte Tarnung. Und Bobby konnte sehr lange unter Wasser schwimmen.
Eine Düne hinauf und dann das letzte Stück über den mondhellen Strand. Es war Flut, er würde es schaffen, kein Problem, und später musste er Max warnen. Er würde einfach so lange im Wasser bleiben, bis diese Schlägertypen von der Bildfläche verschwanden. Dann zu der Landzunge schwimmen. Ganz einfach.
Als er losgerannt war, hatte er Peaches’ Namen in die Nacht gerufen. So laut er konnte. Hatte gebrüllt, sie solle weglaufen. Sich verstecken. Aber der Angriff hatte ihn völlig überrumpelt. Die Typen hatten sich zwischen den Büschen und Bäumen hinter den Dünen versteckt. Ihre Motocross-Maschinen jaulten einmal kurz auf, die Räder wühlten im
Weitere Kostenlose Bücher