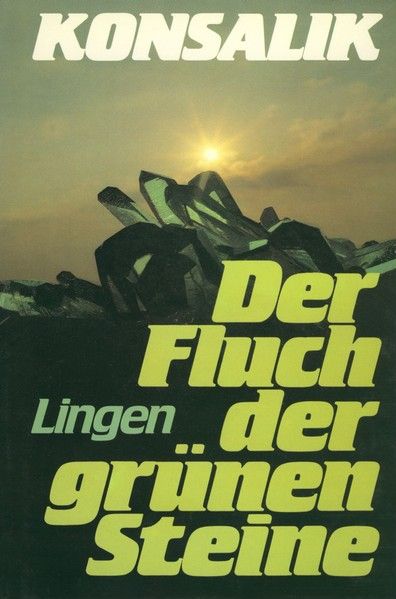![Der Fluch der grünen Steine]()
Der Fluch der grünen Steine
Juan. Aus der Ferne geht das nicht.«
»Sie ist hier.«
Er pfiff durch die Zähne und winkte. Aus der Dunkelheit lösten sich kleine und größere Schatten. Es sah aus, als würden Gestalten aus den Felsritzen quellen. Dann standen sie im Schein des offenen Feuers: eine zarte, kleine Frau mit langen, bis zu den Kniekehlen reichenden Haaren und indianischen Augen, zehn Kinder von 14 bis zwei Jahren, in zusammengenähten Lumpen gehüllt. 22 Augen, im flackernden Feuer übergroß und glänzend, sahen Dr. Mohr an. Das kleinste Kind hielt sich am Rock der Mutter fest und steckte den Daumen in den Mund. Ein Skelett, mit blasser, fast olivfarben schimmernder Haut überzogen.
»Sie sind alle sauber und gewaschen!« sagte Zapiga. »Ich weiß, was sich gehört, wenn man zu einem Médico geht.« Er pfiff wieder. Der älteste Junge trat an seine Seite. »Das ist er, der den Arm nicht hochheben kann. Aber ich brauche ihn. Er ist kräftig genug, um im Berg mit mir zu graben. Was kostet es?«
»Was?« fragte Dr. Mohr etwas verwirrt. Er blickte die Familie der Reihe nach an. Da haben wir alles, dachte er. Tuberkulose, Anämie, Skorbut, Furunkulose, Eiweißmangel, Eisenmangel, Kalziummangel, sämtliche Formen der Hungerdystrophie, wahrscheinlich auch schon Veränderungen der Knochen.
»Die Untersuchung.«
»Nichts.«
Juan Zapiga schien nicht zu begreifen. Daß man etwas tat, ohne Lohn dafür zu verlangen, war jenseits seines Begriffsvermögens. Er griff in seinen Gürtel, holte das berühmte, verknotete Taschentuch der Guaqueros hervor und knüpfte es auf. Der Junge neben ihm zog mit der linken Hand einen Revolver aus dem Gürtel und trat zur Seite. Auch der zweite Sohn, vielleicht zehn Jahre alt, hatte plötzlich eine Waffe in der Hand. Die kleine, zarte Frau, vom Kindbett ausgelaugt, drückte ihr Jüngstes an sich und umklammerte mit der Rechten eine Pistole. Sie hatte sie unter dem weiten Rock hervorgezogen.
Dr. Mohr sah sich betroffen um. Im Eingang der Höhle standen Margarita und Maria Dolores. Auch sie hielten Waffen in den Händen, langläufige Gewehre, und es war, das sah er, nicht das erstemal, daß sie so, zu allem bereit, vor ihrem Haus standen. Pebas selbst hatte sich nach vorn gebeugt. Zwischen seinen Beinen lag, griffbereit, sein schwerer Revolver.
»Nur eine Vorsichtsmaßnahme«, sagte er. »Juan packt seine Smaragde aus. Weiß man, ob man beobachtet wird? Überall sind Augen. Kein Guaquero knüpft sein Taschentuch auf, ohne sich nicht nach allen Seiten zu sichern. Aus den besten Freunden wurden schon Mörder – der Anblick der grünen Steine läßt Ehrgefühl und Freundschaft vergessen.«
Zapiga wartete. Er hockte sich, vorsichtig wie ein Tier, das sich an einer Tränke niederläßt und ständig die Gefahr ahnt, näher ans Feuer und breitete sein Taschentuch aus. Ein kleines Häufchen Smaragde glitzerte im Feuerschein, bizarre Formen grünen Kristalls, rund, mehreckig, lanzettenhaft, zwei wie winzige Säulchen.
»Das ist alles, was ich habe«, sagte Zapiga. »Dafür habe ich drei Jahre gearbeitet. Nicht genug, um aufzuhören und mit Frau und zehn Kindern in die Stadt zu ziehen. Nicht genug, um ein Stück Land zu kaufen und eine Finca aufzumachen. Aber ich weiß, wir alle hier wissen es: In unserem Berg liegt der ganz große Stein! Ich träume von ihm, jeden zweiten Tag träume ich von ihm. In einem dieser Träume stand sogar einmal ein Engel vor mir. Begreifen Sie das, Doctor? Ein richtiger Engel mit Flügeln. Er sagte zu mir: Juan! Habe Geduld! Ich kann nicht für dich die Felsen sprengen, aber du kannst dich hineinwühlen. Glaube an dein Glück! – Verdammt ja, Doctor, ich glaube daran. Aber bis ich es habe, das Glück, sterben sie mir alle weg. Die Frau, die Kinder … Nehmen Sie sich, was Sie wollen. Vielleicht den da? Den länglichen? Der bringt geschliffen einen Karat. Beste, reinste Qualität. Nicht einmal eine Wolke darin.«
»Ich nehme nichts«, sagte Dr. Mohr leise. »Juan, pack die Dinger wieder weg.«
»Sie wollen uns wegschicken? Krank und elend?«
»Ich behandele euch umsonst.«
»Umsonst? Und wovon leben Sie?«
»Ich habe Geld genug.«
Zapiga schlug das Taschentuch um seine Smaragde und verknotete es wieder. »Er ist ja gar kein Médico –«, sagte er dabei zu Pebas. »Er ist ein Verrückter!«
»Das sage ich auch. Aber was will ich machen? Besser, er wohnt bei mir als bei den anderen.«
»Fangen wir also an.« Dr. Mohr kniete sich auf den felsigen Boden. Meine erste Ordination
Weitere Kostenlose Bücher