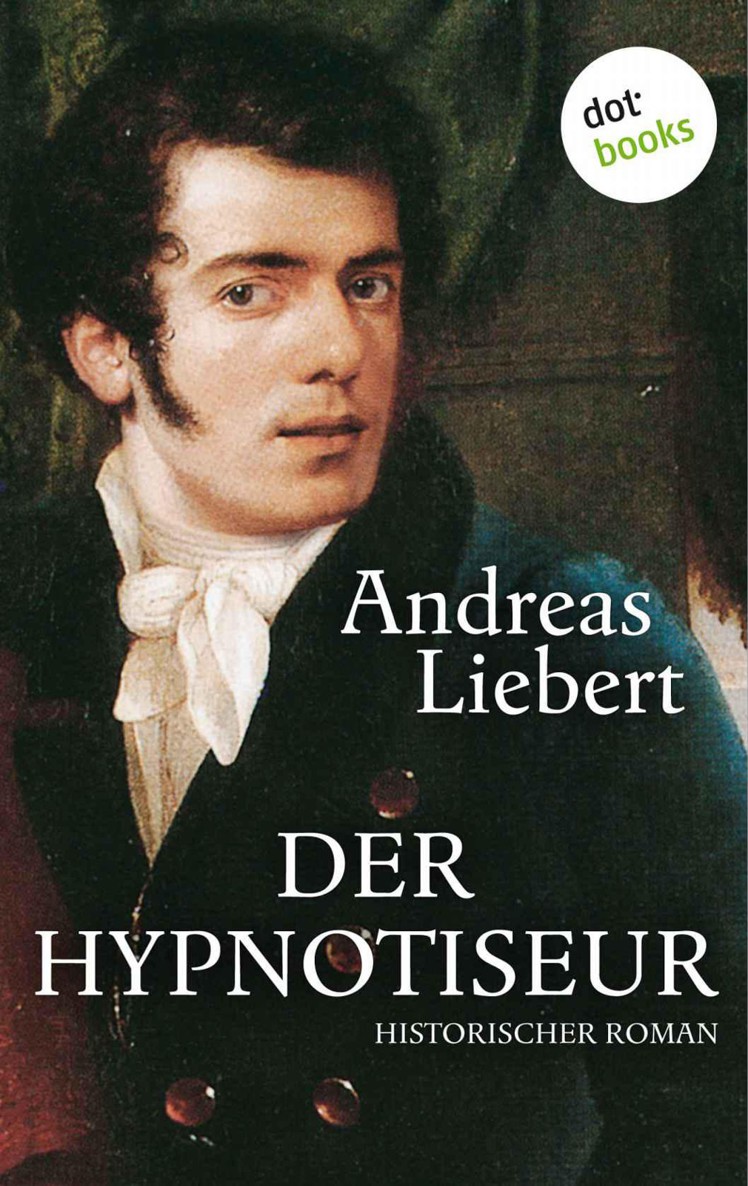![Der Hypnotiseur: Historischer Roman (German Edition)]()
Der Hypnotiseur: Historischer Roman (German Edition)
wie der Hund allmählich schneller und schneller wurde und schließlich in einem ungeheuren Sprung auf mich zuflog. Ich schlug mit meinem Zylinder um mich, aber eine solche Waffe taugt natürlich nicht gegen ein gefletschtes Hundegebiß. Im ersten Augenblick spürte ich nur den Druck der sich verkrampfenden Kiefer, doch dann kam der Schmerz. Das Viech riss an meinem Arm, grollend, die Schnauze schaumig, Mordlust in den Augen.
Mit dem Mut der Verzweiflung warf ich mich auf den Boden und wälzte mich mit allem Schwung herum. Der Schnauzer kugelte damit in eine Art halbe Rückenlage, wodurch es mir irgendwie gelang, ihm meinen freien Arm auf die Brust zu dreschen und ihn dabei unter mir zu begraben. Ein einziger, unbändiger knurrender und geifernder Muskel lag jetzt unter mir, aber meine Schenkel waren wie ein Schraubstock.
Ich herrschte den Hund an, aber nicht hysterisch oder gar verzweifelt. Wahrscheinlich sah es aus, als wollte jetzt ich dem Viech meine Zähne in den Hals schlagen oder es hypnotisieren. Tatsächlich konzentrierte ich mich darauf, alle Kraft in meine Faust zu legen. Ich kroch ein Stück nach vorn, Blitze und Donner in meinem Blick - dann krachte meine Faust auf den Hundeschädel, einmal, zweimal. Der Beißkrampf lockerte sich, ich bekam den Arm frei. Ein letztes Mal sammelte ich meine Kräfte, schob mich noch einmal ein Stück vor und rammte dem Hund das Knie unter die Schnauze. Er jaulte auf, begann zu röcheln. Seine Kraft war gebrochen. Und genau in diesem Moment ergriff mich der Hass. Während ich mit dem Knie nachdrückte, verkrallte ich mich in die Nackenhaare - und schmetterte den Kopf mit einem entschlossenen Ruck nach hinten. Mit widerlichen Knacken brach das Genick. Michels Schnauzer erschlaffte und fühlte sich mit einemmal nur noch an wie ein schlecht ausgestopftes Balg.
Erst nachdem ich wieder einigermaßen zu mir gekommen war, erinnerte ich mich daran, wem ich dieses Spektakel verdankte. Ich schaute um mich, doch niemand hatte den Kampf bemerkt. Und Michel war bereits wieder verschwunden.
Noch eine Viertelstunde bis zur Abfahrt des Omnibus-Wagens nach Paris. Der Ärmel meines Rocks hing in Fetzen, das Hemd darunter war blutdurchtränkt.
Ich taumelte ins Haus. Mein Mund war ausgetrocknet, und mein Arm brannte bei jeder Bewegung. Zum Glück war der Wasserkrug im Schlafzimmer noch voll. Ich leerte ihn in die Waschschüssel und tauchte das Gesicht hinein. Nachdem ich meine Stirn gekühlt hatte, ließ die Hitze nach, und die Selbstbeherrschung kehrte zurück. Ich wand mich aus Gehrock und Hemd, zog ein frisches Taschentuch aus dem Nachtschrank und tränkte es mit Franzbranntwein. Als ich es auf die Wunde legte, überfiel mich sofort große Erleichterung. Das Blut war bereits geronnen, mit ein bisschen Glück würde es keine Komplikationen geben. Denn Michels Schnauzer waren zwar beiß-, nicht aber tollwütig.
Der Omnibus-Wagen!
Ich lauschte auf das Rasseln und Hufeschlagen, den kurzen Moment der Stille, zählte die Sekunden, bis die Peitsche knallte und die Pferde wieherten. Trappeln, Ächzen, rollende, sich entfernende Räder. Dann eben morgen, dachte ich und sah im Geist die sich immer schneller drehenden Speichen. Wenigstens half der Franzbranntwein. Nach einer Weile ebbten die Schmerzen ab und verschwammen zu einem dumpfen Pulsieren. Ich wickelte etwas Leinen um meinen Arm und gönnte mir zur weiteren Beruhigung sechs Tropfen Laudanum. Ich legte mich sofort ins Bett. Es dauerte keine Minute, da war ich eingeschlafen.
2.
Als ich erwachte, fühlte ich mich elend. Doch nicht der Wundschmerz plagte mich, sondern mein Gewissen. Ich machte mir Vorwürfe wegen des toten Hundes. Ausgerechnet ich, der ich nicht müde wurde, Milde bei den Barmherzigen Brüdern einzufordern, hatte einer Kreatur das Genick gebrochen. Ich hätte mit Michel sprechen, freundlicher sein sollen. Andererseits, hatte ich eine andere Wahl? Der Schnauzer hätte mich zerrissen, wäre er stärker gewesen.
»Also, in dubio pro reo.«
Ich setzte mich auf und stierte von der Bettkante aus vor mich hin. Vielleicht bin ich wirklich zu weich, sprach ich mit mir selbst. Vielleicht ist es ja ganz normal, zu töten. Jäger tun es täglich, der Henker auch und Soldaten sowieso. Im Waschkrug entdeckte ich mein verzerrtes Spiegelbild, versuchte mich an einem aufmunternden Lächeln. Doch mein Kopf war leer. Schaffe das Viech unter die Erde und dann vergiß diesen mißratenen Tag. Wozu sonst gibt es volle Weinflaschen?
Statt im
Weitere Kostenlose Bücher