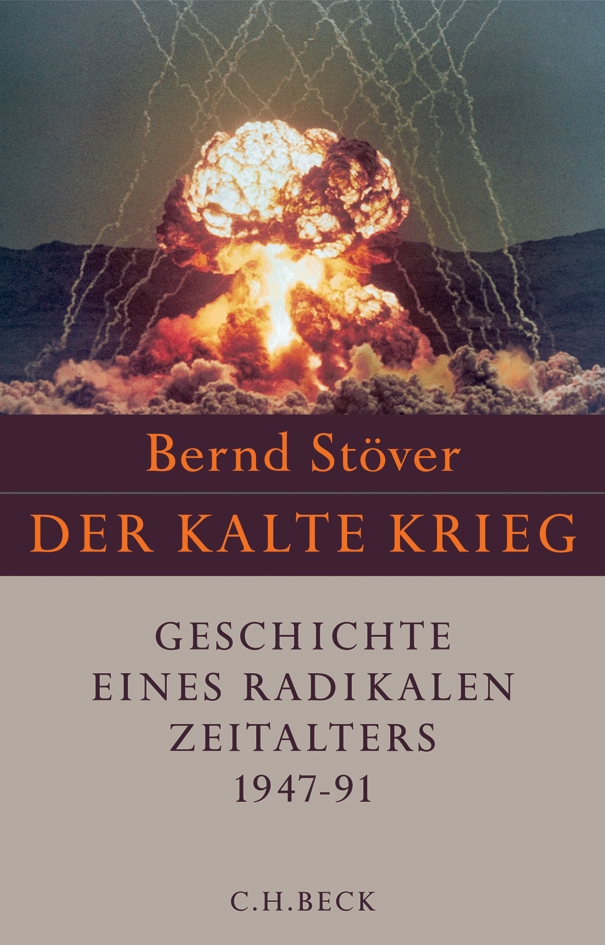![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
Zwischen 1969 und 1971 brannten «Amerikahäuser» in verschiedenen Städten der Bundesrepublik, seit 1972 wurden Einrichtungen der US-Armee zum Ziel von Sprengstoffanschlägen der «Rote-Armee-Fraktion» und ihrer Nachfolger.
Bereits am 2. Juni 1967 fanden die Proteste in Westdeutschland ihren ersten und im Rückblick folgenreichsten Höhepunkt. Während einer Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien wurde der unbeteiligte und vor allem unbewaffnete Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen. Die vom Schah regierte und seit 1953 von den USA massiv unterstützte «Diktatur der Freien Welt» 66 symbolisierte für viele eine der schmutzigsten Seiten des Kalten Krieges. In der Bundesrepublik wurde der Tod Ohnesorgs tatsächlich zum Fanal, an dem sich schließlich auch die Studentenbewegung schied. Es war kein Zufall, daß sich die terroristische «Bewegung 2. Juni» auf sein Todesdatum berief. Am ungeklärten Verhältnis zur Gewalt, die weitere Höhepunkte während der Ostertage 1968 und schließlich im Attentat auf Dütschke selbst fand, zerbrach schließlich die 68er-Bewegung. Während ein Teil den «Marsch durch die Institutionen» antrat und auf lange Sicht einige gesellschaftliche Reformen tatsächlich durchgesetzt werden konnten, ging ein ungleich gewaltbereiterer Teil den Weg in den Terrorismus. In Westdeutschland verübten die 1970 gegründete RAF, die sich in ihrem politischen Selbstverständnis als Verbündete sowohl der Dritten Welt als auch der kommunistischen Staaten sah, bis in die neunziger Jahre blutige Anschläge. Dennoch ist die 68er-Bewegung keine Geschichte in die «Endstation Terror», wie manche Kritiker pointiert formulierten. 67 Vor allem die seit Mitte der siebziger Jahre auftretende Vielzahl von Bürgerinitiativen als «Neue Soziale Bewegungen», die sich zum Beispiel gegen die zivile Nutzung der Atomkraft, aber auch gegen die neuen Aufrüstungsrunden des Kalten Krieges wandten, sind ohne «die Achtundsechziger» kaum denkbar.
Kalter Bürgerkrieg: Die Feinde und die Freunde
Der Kalte Krieg war nicht erst seit «68» auch eine innergesellschaftliche Auseinandersetzung mit den angeblichen oder tatsächlichen Parteigängern des jeweils anderen Lagers. Dieser bereits in den fünfziger Jahren als «Kalter Bürgerkrieg» bezeichnete Konflikt war jeweils unterschiedlich stark ausgeprägt, aber immer präsent. Während sich im Osten die staatliche Repression relativ einheitlich von oben nach unten entfaltete, zogen sich die Fronten im Westen zum Teil quer durch gesellschaftliche Organisationen.
Gewerkschaften und Kirchen etwa in der Bundesrepublik waren trotz des antikommunistischen Konsenses seit den fünfziger Jahren in der Friedensbewegung aktiv und wurden deswegen verdächtigt, Parteigänger des Ostens zu sein.
Im sowjetischen Machtbereich gehörte die Verfolgung von Andersdenkenden und Abweichlern ebenso wie die gezielte Förderung von Loyalität lange vor dem Kalten Krieg zum Alltag. Die verschärfte Verfolgung begann mit dem Ausschluß Jugoslawiens aus der Kominform 1948. Reihenweise wurden danach «nationali-stisch-titoistische» Abweichler als Parteigänger des Westens verfolgt und teilweise in aufsehenerregenden Schauprozessen abgeurteilt. Solche Verfahren fanden unter anderem in Albanien, Rumänien, Polen, Ungarn, Bulgarien und der Tschechoslowakei statt und endeten mit zahlreichen Todesurteilen. Auch in der DDR liefen seit 1949 Prozeßvorbereitungen, allerdings fand kein Verfahren statt. 68 Bis zum Ende des Ostblocks wurden «Dissidenten» verfolgt, jene, die sich zwar zum Marxismus-Leninismus bekannten, aber den «real existierenden Sozialismus» umgestalten wollten. Sie verschwanden in Lagern oder Gefängnissen, wurden unter Hausarrest gestellt oder - seit den siebziger Jahren - «ausgebürgert».
Ein bekanntes Beispiel in der Sowjetunion war der Schriftsteller Alexander Solschenizyn. Er hatte bis zur Entstalinisierung
1956 in verschiedenen Lagern leben müssen, konnte aber am Ende der Chruschtschow-Ara seine Erzählung Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch veröffentlichen. Ab 1967 war er dann wegen seines öffentlichen Engagements für die Aufhebung der Zensur in der UdSSR endgültig zur Unperson erklärt worden. Drei Jahre später verweigerte man ihm die Ausreise zur Entgegennahme des Literaturnobelpreises. 1974 wurde er schließlich ausgebürgert. Ein Dissident aus den Reihen der Naturwissenschaftler war der an der Entwicklung der sowjetischen H-Bombe
Weitere Kostenlose Bücher