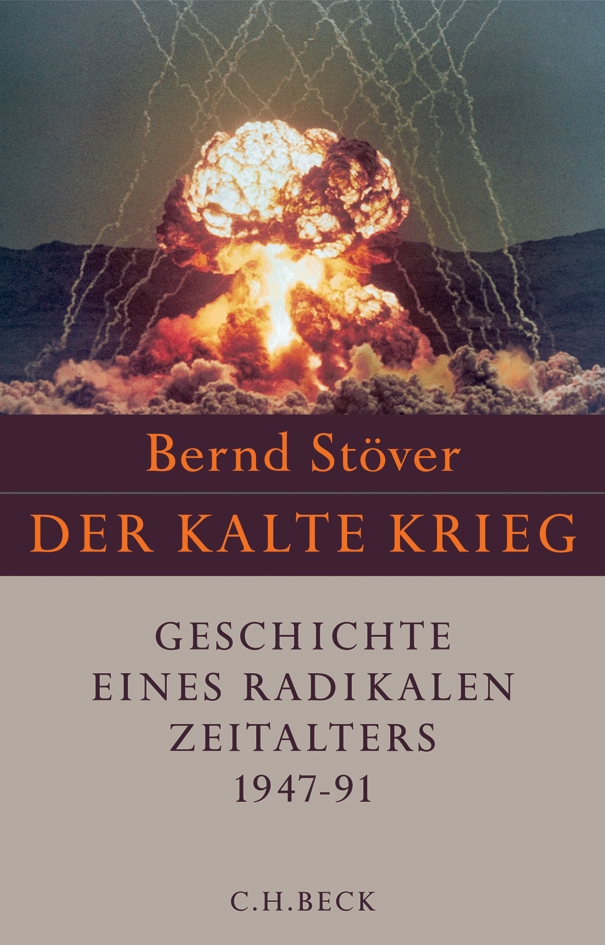![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
Öffentlichkeit im Kalten Krieg letztendlich doch am meisten vertraute, wurde er 1954 mittels einer vom Senat ausgesprochenen Standesrüge aus dem politischen Leben entfernt. Allerdings war auch danach der Kampf gegen Abweichler aus der Front des Kalten Krieges nicht zu Ende. In den USA wurde McCarthys Arbeit bis weit in die sechziger Jahre durch seinen Kollegen Patrick McCarran fortgesetzt. Insbesondere der Vietnamkrieg schuf neue Gräben, in denen die Behörden massiv gegen «Linke», vor allem gegen die 1962 gegründete Studenfs for a Democratic Society (SDS) vorgingen. Zu den Höhepunkten gehörte in dieser Phase die Erschießung von vier Studenten bei einer Antikriegsdemonstration auf dem Gelände der Kent State University im US-Bundesstaat Ohio am 4. Mai 1970.
Auch in der Bundesrepublik ging man während des Kalten Krieges viel härter gegen die Linke als gegen die Rechte vor. Insgesamt wurden, vor allem nach dem KPD-Verbot 1956, Millionen von Verfahren eröffnet. 75 Zur Verurteilung reichte es nur bei zwanzig Prozent. Auch ansonsten wurde eindeutig mit zweierlei Maß gemessen. Die aus den fünfziger Jahren stammende Überprüfung von Bewerbern für den Öffentlichen Dienst mit Regelanfrage beim
Verfassungsschutz und möglichem «Berufsverbot» richtete sich noch in den siebziger Jahren fast ausschließlich gegen Linke. Das war schließlich dermaßen umstritten, daß 1978 sich sogar ein international besetztes Tribunal zum Schutz von Menschenrechten konstituierte, welches die sozialliberale Bundesregierung unter Helmut Schmidt wegen ihrer Verfahrensweise verurteilte. Ein Jahr später schafften die damals sozialliberal regierten Bundesländer das Verfahren gänzlich ab, die unionsgeführten schränkten es zumindest ein.
Das KPD-Verbot 1956 war der wohl sichtbarste Ausdruck des bundesdeutschen Freund-Feind-Schemas im Kalten Krieg. Die KPD hatte zwar nach 1945 tatsächlich einige Erfolge vorweisen können. Das 1956 verkündete Verbot traf aber eine Partei, die bereits auf dem Weg in die politische Bedeutungslosigkeit war. Insgesamt war die Verfolgung seit dem Beginn des Koreakrieges kontinuierlich verschärft worden, wobei sich die Gerichte bei Verfahren gegen Kommunisten in den folgenden Jahren regelmäßig auf das Delikt der Staatsgefährdung beriefen. Erst zwölf Jahre nach dem KPD-Verbot, am 27. Oktober 1968, konnte sich mit der DKP wieder eine legale kommunistische Partei in der Bundesrepublik etablieren. Auch sie blieb allerdings wenig erfolgreich. Mittlerweile weiß man durch die Öffnung der DDR-Archive und die Informationen über eine geheime Militärorganisation, die «Gruppe Förster», daß die DKP tatsächlich keineswegs so verfassungstreu war, wie sie vorgab. Darüber hinaus gelang es der ostdeutschen Staatssicherheit, in einzelne bundesdeutsche Gruppen und Institutionen einzudringen. Im westdeutschen Studentenbund SDS gab es eine Reihe ihrer Inoffiziellen Mitarbeiter, so Peter Heilmann, Walter Barthel oder Dietrich Staritz. Dutschke selbst allerdings, der Anfang 1965 in den SDS eintrat, geriet als Zentralfigur des westdeutschen Studentenprotests nicht nur ins Visier der westlichen Sicherheitsorgane, sondern als «Anarchist» auch ins Schema des MfS, zumal er den Militärdienst in der DDR verweigert hatte und ein «Republikflüchtling» war. Faktisch blieben aber alle kommunistischen Gruppierungen in der Bundesrepublik politisch bedeutungslos. Eine Lenkung bundesdeutscher Institutionen oder der Presse durch Geheimdienste des Ostblocks, wie es im Kalten Krieg, aber gerade auch nach 1991 hin und wieder vermutet wurde, gab es nicht.
Blockübergreifend läßt sich das Freund-Feind-Schema des Kalten Krieges besonders eindrücklich auch am Beispiel der Förderund Zensurpraxis in Literatur und Film zeigen. In Deutschland hatten bereits unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einige Autoren, die vor den Nationalsozialisten ins Exil geflohen waren und in das jetzt in politische Interessensphären geteilte Land zurückkehrten, einschlägige Erfahrungen mit radikalen In-und Exklusionen. 76 Bis zum Ende des Jahres 1948 fand hier eine für viele Jahre gültige Teilung zwischen der Gruppe der «kommunistischen» und der Gruppe der «bürgerlichen» Schriftsteller statt. Johannes R. Becher etwa, einer der Vorzeigeautoren der SBZ/DDR, wurde von Ostberlin mit hohen Auflagen gefördert. In den Westzonen waren seine Werke ab 1948 dagegen nur noch schwer zugänglich. Umgekehrt war es ebenso:
Weitere Kostenlose Bücher