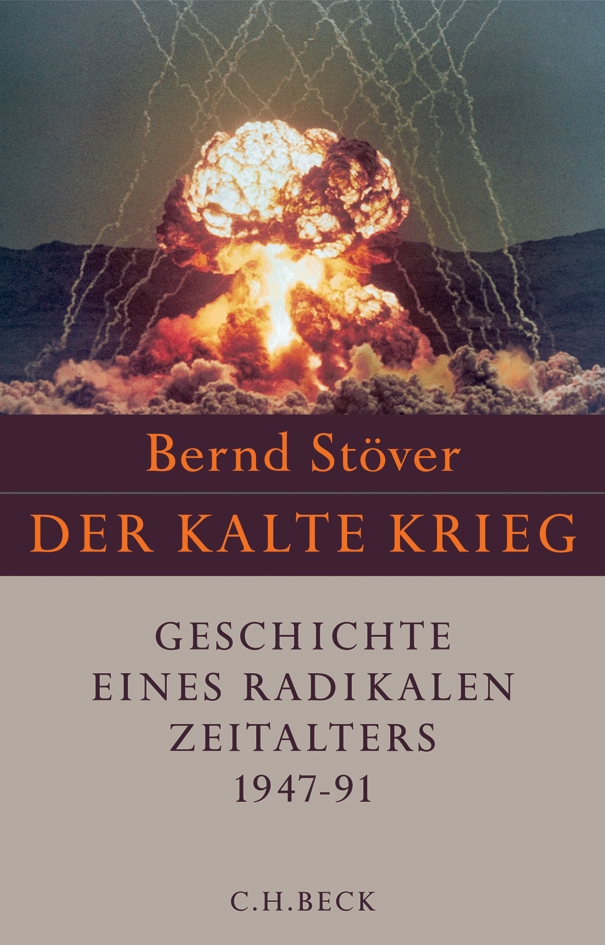![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
Füßen, obwohl sich Hunderttausende an den Kundgebungen beteiligten. Das Hauptproblem bestand in der unterschiedlichen politischen Ausrichtung, zum Teil auch in den gegenseitigen Vorbehalten, etwa zwischen der SPD und den Kirchen. Trotzdem gelang 1955 zum ersten Mal eine überparteiliche Sammlung der Wiederbewaffnungsgegner in der sogenannten Paulskirchenbewegung. Am 29.Januar verabschiedeten Spitzenvertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der SPD, der FDP und der Evangelischen Kirche in Frankfurt am Main ihr gemeinsames «Deutsches Manifest». Es sprach sich unter dem Motto «Rettet Einheit, Frieden und Freiheit! Gegen Kommunismus und Nationalismus!» vor allem auch gegen die Integration der beiden Teile Deutschlands in die politisch-militärischen Blöcke aus. «Die Aufstellung deutscher Streitkräfte in der Bundesrepublik und in der
Sowjetzone muß die Chancen der Wiedervereinigung für absehbare Zeit auslöschen und die Spannung zwischen Ost und West verstärken», hieß es dort unter anderem. 53 Die politische Wirkung der zunächst starken Protestbewegung zerbröckelte allerdings rasch. Man hat dies unter anderem darauf zurückgeführt, daß sich weder die Gewerkschaften noch die SPD zu einem Generalstreik entschließen mochten, um über diesen Weg die Wiederbe-waffhung zu verhindern. Der Streik wäre zwar illegal gewesen, doch auch 1952 hatte es bereits einen ähnlichen politischen Erzwingungsstreik zur Durchsetzung des Betriebsverfassungsgesetzes gegeben. Warum man darauf verzichtete, blieb umstritten. Insgesamt war es wohl ein Bündel von Motiven, deren Ursachen zum Teil in den Mechanismen des Kalten Krieges selbst lagen. Dazu gehörte die Furcht, den mühsam erreichten Grad der Normalität im Wiederaufbau zu gefährden, aber auch die Abneigung, ausgerechnet die SED in Ostberlin zum Bundesgenossen zu haben. Nicht zuletzt fehlte aber auch ein glaubwürdiges Alternativmodell.
Neuen Elan erhielt die pazifistische Bewegung zwei Jahre später, als es 1957 um die indirekte bundesdeutsche Teilhabe an Atomwaffen ging. 54 Zwar hatten die Amerikaner bereits im März
1955 erste Nuklearwaffen in der Bundesrepublik stationiert, doch dies war kein Thema für die Öffentlichkeit gewesen. Fahrt gewann die Debatte erst, als Adenauer am 5. April 1957, nach einer Großen Anfrage der SPD-Fraktion im Bundestag, seine berühmt-berüchtigte Presseerklärung zu den Atomwaffen abgab, die - wohl anders, als er selbst erwartet hatte - von überraschend vielen als unzulässige Verharmlosung aufgefaßt wurde. Taktische Atomwaffen, so hatte Adenauer vor Journalisten ausgeführt, seien «im Grunde nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Artillerie [...], das sind ja beinahe normale Waffen [,..].» 5S
Die Reaktion folgte ebenso prompt wie heftig. Achtzehn führende Atomwissenschaftler der Bundesrepublik - unter ihnen Otto Hahn, Werner Heisenberg, Max Born, Max von Laue und Carl Friedrich von Weizsäcker - wiesen in ihrer «Göttinger Erklärung» mit scharfen Worten darauf hin, daß «jede einzelne taktische Atombombe oder -granate [...] eine ähnliche Wirkung [habe] wie die erste Atombombe, die Hiroshima zerstört hat». Alle seien in der Lage, eine kleine Stadt zu zerstören. 56 Mit der Stellungnahme des Expertengremiums schien ein Damm gebrochen. Weitere No-
Proteste gegen den kalten krieg Der Schriftsteller Erich Kästner während einer Ansprache beim Ostermarsch 1961. Ihr primäres Ziel, die atomare Bewaffnung der Bundeswehr zu verhindern, erreichten die Proteste nicht.
belpreisträger schlossen sich an, unter ihnen auch Albert Schweitzer und der in den USA tätige Biochemiker Linus Pauling. Schließlich äußerten sich selbst konservative Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine kritisch zu Adenauers Verlautbarungen. Am 22. Februar 1958 wurde dann eine eigene Kampagne unter dem Namen Kampf dem Atomtod ins Leben gerufen, und sie konnte für wenige Monate tatsächlich rund anderthalb Millionen Bundesbürger mobilisieren. Umfragen ergaben, daß über 80 Prozent der Westdeutschen den Bau von Raketenbasen ablehnten; 52 Prozent befürworteten sogar Streiks, um eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr zu verhindern. 57 Massenkundgebungen, wie sie dann auch wieder während der «Nachrüstungsdebatten» in den achtziger Jahren stattfanden, gab es in Hamburg mit 150 000 oder Frankfurt mit 42 000 Teilnehmern. Und dieses Mal kam es sogar zu Streiks, unter anderem im Volkswagenwerk Kassel. Der Schriftsteller Erich Kästner - auch
Weitere Kostenlose Bücher