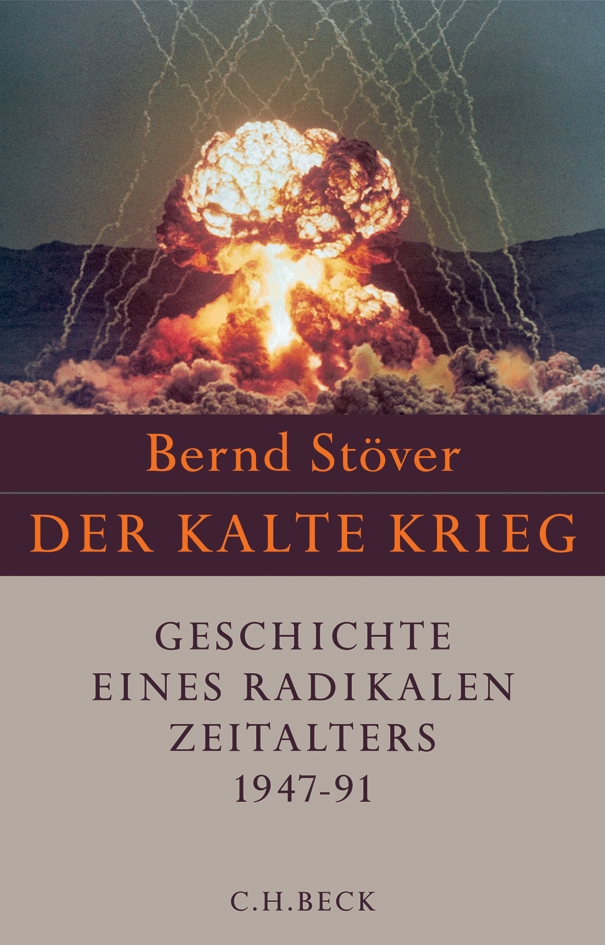![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
«Bürgerlich-imperialistische» Autoren blieben in der SBZ/DDR politisch verpönt. «Literatur», hieß es in ihren amtlichen Begutachtungsrichtlinien aus dem Jahr 1960 umfassend, «die sich gegen den Aufbau des Sozialismus in der DDR, gegen die Erhaltung des Friedens, gegen die Prinzipien des proletarischen Internationalismus und gegen die Einheit des sozialistischen Lagers ausspricht, antihumanistische und den Marxismus-Leninismus verfälschende revisionistische Literatur, darf in der DDR nicht erscheinen.» 77 Dies traf insbesondere auch Autoren, die, wie Uwe Johnson, in den Westen übergesiedelt waren und nun als Verräter galten. Obwohl Johnsons Werke inhaltlich eng mit der DDR verbunden blieben, wurden sie dort nicht einmal rezensiert.
In der Filmzensur der DDR traf es je nach aktueller politischer Linie unterschiedliche Bereiche, so daß im gleichen Film in verschiedenen Jahren jeweils andere Sequenzen herausgeschnitten wurden. Wolfgang Staudtes 1950 uraufgeführter Spielfilm Der Rat der Götter wurde 1953 wegen einer militärkritischen Passage gekürzt. Zehn Jahre später, nach dem chinesisch-sowjetischen Eklat, mißfiel den SED-Zensoren dagegen vor allem die Schlußszene, die großflächig die Pekinger Führung zeigte. 78 Nur wenigen Aushängeschildern des SED-Kulturbetriebs, Bertolt Brecht etwa und -etwas weniger - auch Anna Seghers, war es möglich, sowohl im Osten als auch im Westen weiter zu veröffentlichen. Nichtsdestoweniger waren auch ihre Bücher im Westen in den fünfziger Jahren teilweise nur gekürzt erhältlich. Es belegt die Mechanismen des Kalten Krieges, daß die auf der einen Seite des Eisernen Vorhangs unerwünschte Literatur auf der anderen Seite fast automatisch in die Kategorie des Förderungswürdigen geriet. So sah sich auch ein Autor wie Alexander Solschenizyn nach seiner Emigration in die USA 1976 unversehens in die Position eines Zeugen gegen den Kommunismus gedrängt. In Westdeutschland war schon dreißig Jahre früher Theodor Plievier in diese Rolle gerückt. Plie-vier hatte zwar bis 1945 im sowjetischen Exil in Moskau und danach auch in der SBZ publiziert. Dort erschien zum Beispiel sein Roman Stalingrad. Als er sich 1947 entschied, in die Westzonen zu gehen, wurde er dort zum antikommunistischen Vorzeigeautoren. Bis 1949 rissen sich die westdeutschen Verlage um ihn. Plievier entzog sich allerdings auch dieser Rolle durch eine erneute Auswanderung, die ihn diesmal in die neutrale Schweiz führte, wo er
1955 starb.
Eine direkte politische Zensur gab es im Westen vor allem in den fünfziger Jahren. In den USA steigerte sie sich während der McCarthy-Ära schließlich sogar zu öffentlichen Bücherverbrennungen. Kommunistische, sozialistische oder auch liberale Autoren verfielen in diesen besonders radikalen Jahren nahezu automatisch dem politischen Verdikt und hatten auch später enorme Probleme, wieder auf dem Markt Fuß zu fassen. Eine indirekte Zensur, die sich entsprechend schwer nachweisen ließ, blieb während des gesamten Kalten Krieges und darüber hinaus ein Thema. 79 In der Bundesrepublik traf die staatliche Zensur in den fünfziger und sechziger Jahren unter anderem Werke von DDR-Vorzeigeautoren wie Brecht, während SED-kritische Dissidentenliteratur, etwa Rudolf Bahros Die Alternative, in den siebziger Jahren ausdrücklich veröffentlicht wurde. Andere Eingriffe betrafen Filme, so die ostdeutsche Produktion Der Untertan, die erst sechs Jahre nach der Uraufführung, Ende 1957, stark gekürzt und mit einem den Inhalt relativierenden Vorspann in die westdeutschen Kinos kam. Wenige Jahre später traf es 1963 den Film Die Eingeschlossenen des italienischen Regisseurs Vittorio de Sica, dessen Kritik an der westdeutschen Industrie und der NATO beanstandet wurde. 80 Während es im Osten nur indirekte Formen gab, die Zensur zu umgehen, regte sich im Westen früh öffentliche Gegenwehr. Schon 1954 kritisierte das westdeutsche PEN-Zentrum offen die Beschlagnahmung von Büchern aus der DDR. Dies seien ungerechtfertigte Eingriffe in die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft. Im Oktober 1961 kam es sogar zu einem großangelegten öffentlichen Protest von 66 Theaterintendanten, die ausdrücklich vor einer «tendenziösen Beeinflussung der Spielpläne durch Gruppen außerhalb des Theaters» warnten. 81 Auch dies forderte selbstverständlich wieder Gegenreaktionen heraus. Speziell an kritische Intellektuelle in Westdeutschland richtete sich seit Mitte der fünfziger Jahre ein
Weitere Kostenlose Bücher