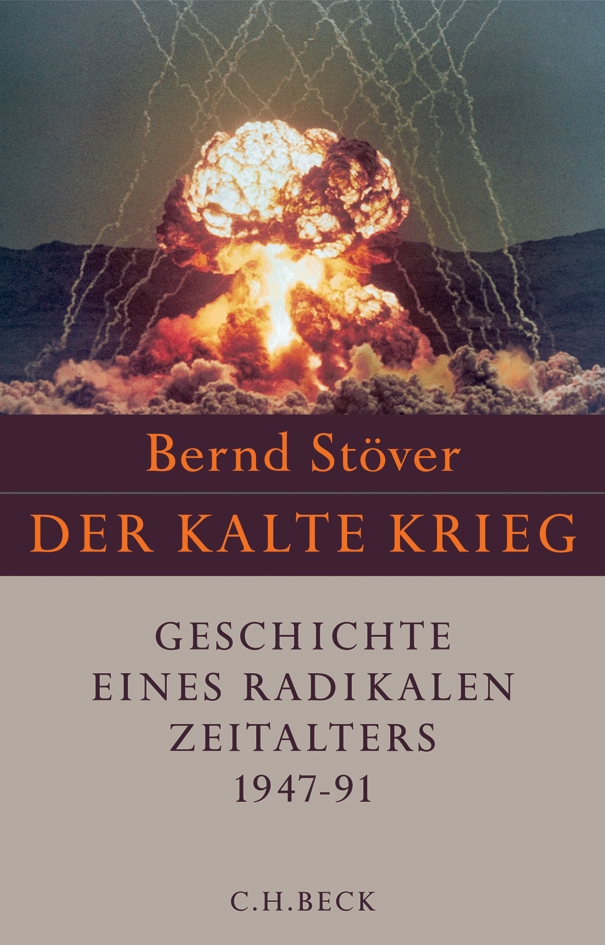![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
bewegten.
Die literarische Auseinandersetzung mit den Inhalten des Kalten Krieges begann im Osten wie im Westen unmittelbar mit dessen Eröffnung. Dies ist sowohl in der anspruchsvollen Kunst- als auch in der Unterhaltungs- und Trivialliteratur nachzuvollziehen. Einige Themen fanden durchgängig besonderes Interesse. Dazu gehörte die Frage nach der besseren politischen Gesellschaftsordnung, die in den Publikationen ebenso wie den F ilm en der beiden Hauptkontrahenten naturgemäß unterschiedlich beantwortet wurde. Weitere Hauptmotive waren die permanente Bedrohung durch Feinde und atomare Vernichtung und nicht zuletzt immer wieder die Frage nach der Stellung und Verantwortung des Einzelnen im globalen Konflikt. Die Antworten waren gar nicht so unterschiedlich wie man vermuten könnte. In der Frage nach Nutzen und Schaden der Atomkraft etwa gab es zeitweilig so etwas wie einen Ost-West-Konsens. Vor allem die utopische SF-Literatur auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs nahm beides auf: den Horror des Nuklearkrieges ebenso wie die Vorteile der Kernspaltung. 20 Exemplarisch verband dies der polnische SF-Autor Stanislaw Lem, der als einer der am meisten übersetzten Autoren des Ostblocks auch im Westen ausgesprochen viel gelesen wurde. In seinen 1957 verfaßten Sterntagebüchern (Dzienniki Gwiazdowe) gab es zwar einerseits den damals typischen nuklearen Zukunftsoptimismus. Andererseits thematisierte Lem in einem Dialog zwischen einem Bewohner der Erde und einem Vertreter einer außerirdischen Zivilisation eine kaum verhüllte Kritik an der Atomrüstung und am destruktiven Umgang mit der Atomenergie. 21 Auch in dem ebenfalls in der Hoch-Zeit des Kalten Krieges 1960 in den USA verfilmten SF-Klassiker The Time Machine, dessen Romanvorlage H. G. Wells bereits 1895 veröffentlicht hatte, war es nicht mehr die von Wells vorgegebene Konstellation, nach der die fortschreitende Separierung der Menschheit in Reiche («Haves») und Arme («Have-Nots») die Welt in die Barbarei führt, sondern die Atombombe.
In den politischen Grundfragen des Kalten Krieges war dieser Ost-West-Konsens, wie er sich in der Nuklearfrage zumindest tendenziell abzeichnete, nicht zu erwarten. Die offiziell geförderte oder geduldete Literatur des Ostblocks vermittelte deutliche Feindbilder. 22 Die «Tatsachenromane» des vielgelesenen ostdeutschen Film- und Buchautors Wolfgang Schreyer, Der Traum des Hauptmann Loy (1956) oder Augen am Himmel (1968), beschrieben die Fronten des Kalten Krieges als Fortsetzung von Imperialismus und Nationalsozialismus. Dennoch gab es auch Arbeiten, die zwischen den Zeilen Kritik an der angeblich einseitigen Verantwortung des Westens für den Kalten Krieg äußerten. Die ansonsten regimetreue DDR-Autorin Christa Wolf thematisierte 1983 in ihrer Erzählung Kassandra eine verhaltene Mitverantwortung beider Seiten für die Auseinandersetzung, wenngleich sich auch ihre Vorwürfe, einen Atomkrieg vorzubereiten, primär gegen die USA richteten. 23 Bekannte ostdeutsche Dissidenten, so der 1952 aus den USA in die DDR zurückgekehrte Stefan Heym, hatten es da schwerer. Sein Roman 5 Tage im Juni (1959) konnte in der DDR bis 1989 nicht erscheinen, obwohl er weitgehend der offiziellen Interpretation folgte, wonach der Aufstand in der DDR im Juni 1953 im wesentlichen ein vom Westen gesteuerter Putsch gewesen sei.
Auch in der westlichen Literatur knüpften die ersten literarischen Arbeiten, die sich mit den politischen Fronten des Kalten Krieges beschäftigten, zunächst an traditionelle Feindbilder an. In die Rolle des totalitären Gegners, die zunächst die Deutschen fast exklusiv besetzten, rückten nun die Kommunisten und die Sowjets. George Orwells Roman Animal Farm (1945), die Geschichte vom Aufstand der Tiere gegen den Menschen und das Scheitern ihrer Revolution durch den Machtmißbrauch in den eigenen Reihen, war bereits eine deutlich antistalinistische Satire. Sein 1949 folgender Roman Nineteen Eighty-Four (1984) war dann einer der ersten und gleichzeitig einer der wirkungsvollsten, die sich literarisch mit den politischen Strukturen des beginnenden Kalten Krieges auseinandersetzten. Bezeichnenderweise hatte Orwell das Thema zunächst ebenfalls als «utopischen Roman» vorbereitet. Im Konstituierungsjahr des Kalten Krieges vermerkte er 1947 jedoch, nun sei das Buch doch tagespolitisch geworden. 24 Inhaltlich erinnerte es tatsächlich eher an die aktuelle Politik des Kalten Krieges als an eine entferntere Zukunft: Drei
Weitere Kostenlose Bücher