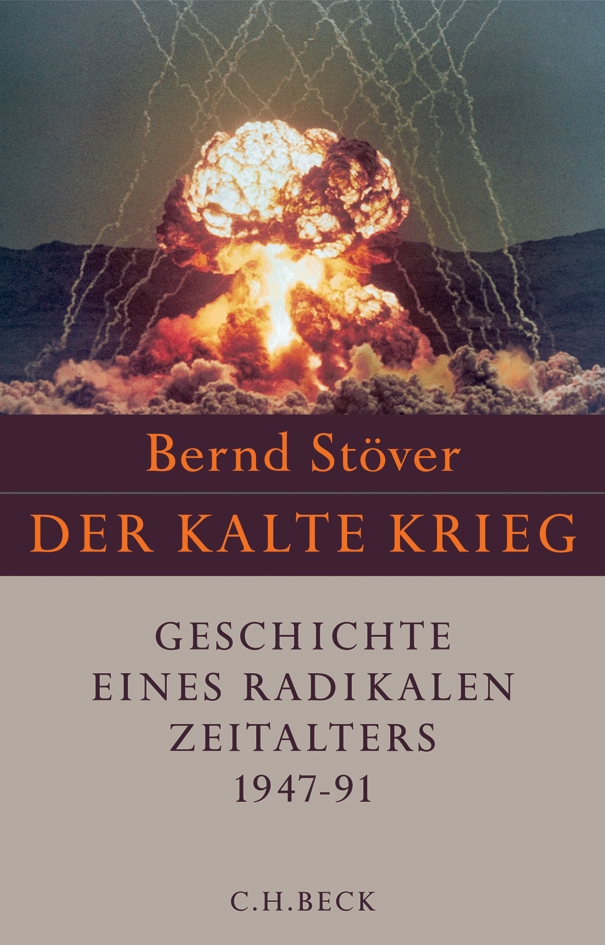![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
etwa Ägyptens unter Nasser in den fünfziger Jahren oder der ölproduzierenden Staaten des Mittleren Ostens in den siebziger und achtziger Jahren - massiv von beiden Supermächten beeinflußt waren. Je nach zugelassenem Freiraum waren sie in der Lage, eigene Chancen wahrzunehmen. Entsprechendes galt für die Vereinten Nationen. Als Organisation funktionierten sie immer nur so gut, wie die Hauptakteure im System es zuließen.
Die Subsysteme des Kalten Krieges - also zum Beispiel die regionalen Mächte mit ihren spezifischen politischen Interessen, Teilungsgesellschaften, die auf ihre Wiedervereinigung zielten, organisierte Religionen oder supranational tätige private Organisationen, aber auch terroristische Gruppen - waren zwar erst recht keine vom Hauptkonflikt autarken Akteure, konnten aber ebenso wie die größeren sekundären Blöcke relativ eigenständig ihre politischen Interessen verfolgen. Die systemtheoretische Herangehensweise erlaubt es, etwa die innerdeutsche Politik als eigenes Untersystem zu beschreiben. Zum Teil gegen den Widerstand der Hauptkontrahenten entstanden hier Entspannungsversuche sowie politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenarbeit zwischen den Blöcken.
Heuristisch bietet die systemtheoretische Herangehensweise aber noch mehr. Die Annahme, daß ein System versucht, sein Gleichgewicht zu erhalten und Störungen auszuschalten, erleichtert das Verständnis für die Tatsache, daß Eskalation und Entspannungsphasen einander ablösten und teilweise sogar parallel verliefen. Nicht zufällig sprachen die Beteiligten während des Kalten Krieges von der Balance der Mächte oder einem Gleichgewicht des Schreckens. Der Stillegung des Kalten Krieges in Europa ab 1961 folgte der militärische Konflikt in anderen Regionen. Fortschritte bei der Abrüstung bestimmter Waffensysteme ließen mit Sicherheit eine Aufrüstung in anderen Waffensystemen folgen. Bezeichnenderweise war die Entspannungspolitik auch im Verständnis der Beteiligten niemals ein Selbstzweck, sondern der Versuch, eine verlorene Balance wiederzuerlangen. Auch die Abrüstungsverhandlungen zwischen den beiden Supermächten waren interessanterweise niemals darauf gerichtet, die Nuklearwaffen insgesamt abzuschaffen - im Gegenteil: Das Gleichgewicht des Systems (oder des Schreckens) sollte in jedem Fall erhalten bleiben, weil es als friedenssichernd galt.
Nicht zuletzt ergibt sich aus der systemtheoretischen Herangehensweise eine Möglichkeit, die lange Dauer des Konflikts zu erklären. Da Systeme nach dem Prinzip der Nützlichkeit arbeiten, werden sie durch positive Ergebnisse und erreichte Vorteile gestärkt. Grundsätzlich schuf der Kalte Krieg bei vielen Beteiligten eine gesellschaftlich akzeptierte Sinnbildung, eine individuelle und kollektive Ordnung sowie politische Disziplinierung. Loyalitätsversicherungen auf der einen und Exklusionen von tatsächlichen oder angeblichen Illoyalen auf der anderen Seite stärkten zwangsläufig den Zusammenhalt, aber auch die Identitätsfindung. Dies betraf nicht zuletzt Teilungsgesellschaften wie Deutschland, Korea oder Vietnam. Auch wirtschaftlich brachte der Kalte Krieg Vorteile. Die enormen Rüstungsprogramme schufen Konjunkturen, die ohne den Konflikt nicht denkbar gewesen wären: Speziell in die Nuklearwaffen- und Raketenprogramme flössen gigantische Summen. Als man nach dem Ende des Konflikts in den neunziger Jahren die Kosten für die Entwicklung, Herstellung und Unterhaltung allein der amerikanischen Nuklearwaffen zwischen 1940 und 1996 berechnete, kam man auf eine Summe von 5,8 Trillionen Dollar. 2 Im Westen sorgte der Wettlauf der Systeme aber auch für hohe Investitionen in die Bildung und nicht zuletzt auch in die sozialen Sicherungssysteme. Deren Umfang wurde für viele erst nach 1991 sichtbar, als im Zuge der Auflösung des globalen Konflikts auch die Sozialsysteme drastisch gekürzt wurden. Auch für bestimmte Entwicklungsländer, nicht zuletzt die blockfreien Staaten, brachte er handfeste finanzielle Vorteile, je nachdem, wie virtuos sie den großen Konflikt für sich zu nutzen verstanden.
Darüber hinaus verhinderte der Kalte Krieg aber auch die Notwendigkeit, nach Lösungen für unbequeme Probleme zu suchen: Die Deutsche Frage blieb nicht nur offen, mit ihr wurden Teile der Vergangenheitsbewältigung, etwa die Frage der Entschädigung von Zwangsarbeitern des Zweiten Weltkriegs, radikal ausgespart. Der nahezu bruchlose Übergang vom Zweiten Weltkrieg in den
Weitere Kostenlose Bücher