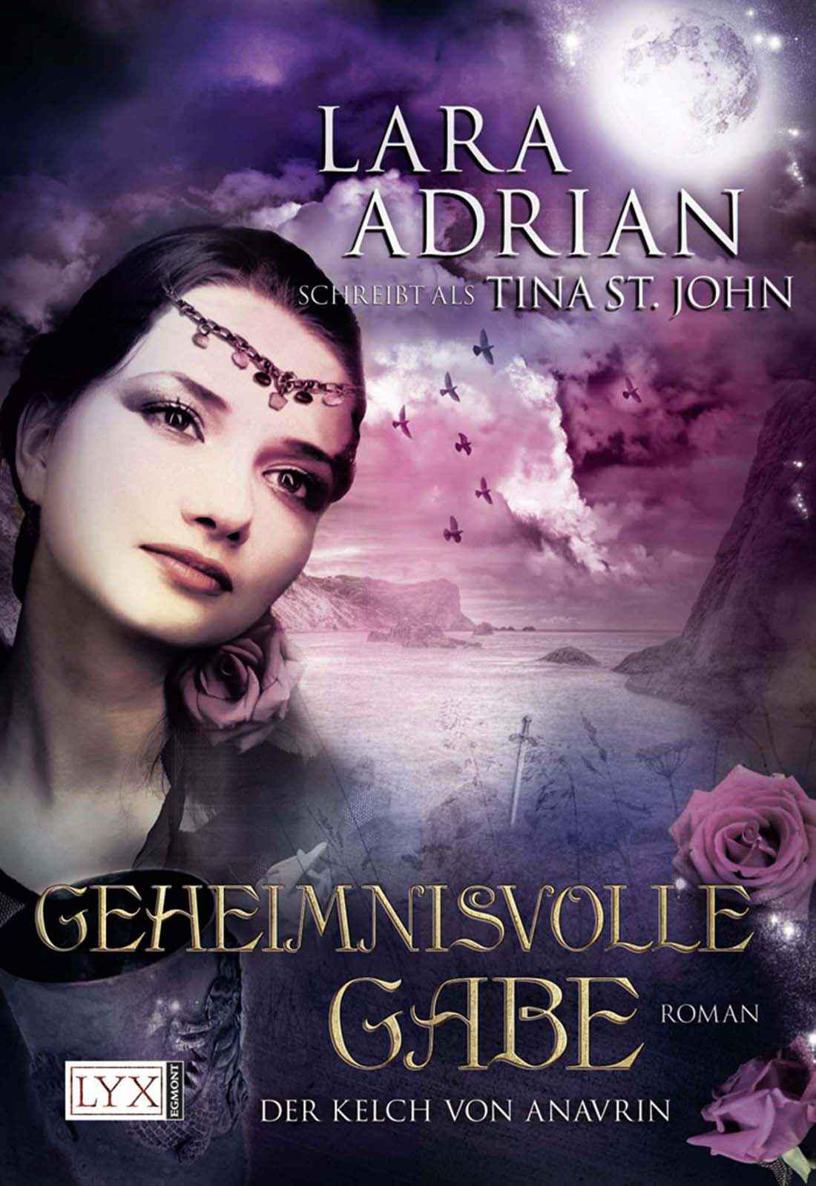![Der Kelch von Anavrin: Geheimnisvolle Gabe (German Edition)]()
Der Kelch von Anavrin: Geheimnisvolle Gabe (German Edition)
Mann nimmt sich lieber das, was er haben möchte, anstatt es als Geschenk anzunehmen.«
Mit einem düsteren Blick bedachte Rand die hochnäsige ältere Frau, aus deren Worten eine tiefe Verbitterung sprach. »Ich möchte eure Fürsorge nicht.«
»Warum nicht?«, fragte Serena in ihrer offenen, unschuldigen Art. »Ihr werdet sie brauchen.«
Fürwahr, er würde sie brauchen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass er irgendeine Wegstrecke ohne ordentliches Schuhwerk würde bestreiten können. Mehr noch, sollte er dennoch die nächste Siedlung erreichen, hätte er keine Mittel, um Kleidung zu erstehen. Er besaß keine Waffe mehr, kein Pferd … Ihm war nichts geblieben. Silas de Mortaine hatte ihn all seiner geliebten Menschen beraubt; das Schicksal hatte ihm den Rest genommen.
Dennoch stand nun Serena vor ihm und bot ihm Essen, Kleidung und Unterkunft an, ohne Vorbehalt und ohne Forderungen zu stellen.
»Wir können die Kleidung nicht mehr gebrauchen«, meinte sie. »Nehmt sie an, Rand.«
Noch immer zögerte er. Serena hielt ihm die Tunika hin und wartete seine Entscheidung ab. Er wäre ein Narr, Dinge auszuschlagen, die ihn näher an das bevorstehende Treffen mit de Mortaine – und damit der Vergeltung – heranbringen konnten, die er herbeisehnte.
Gott allein wusste, dass er jeden Vorteil brauchte, den er erlangen konnte, und sei es in Form von Kleidung.
Rand streckte den Arm aus und nahm Serena die Tunika langsam aus den behandschuhten Händen.
»Hab Dank«, murmelte er. Sie lohnte es ihm mit einem warmen Lächeln.
»Gern geschehen.«
Er vergrub die Faust in dem groben Gewebe und spürte, wie sich seine Stirn in Falten legte, als er begriff, dass er soeben einen Fehler gemacht hatte. Mit ihrem offenen Lächeln und ihrer arglosen Art hatte ihm Serena so viel mehr angeboten, als ihr bewusst war. Es ging um mehr als einen zaghaften Frieden und eine dürftige Ansammlung abgetragener Kleider. Sie bot ihm Hoffnung, und das konnte sich noch als das gefährlichste Geschenk erweisen, das er überhaupt von einem anderen Menschen anzunehmen in der Lage war.
Calandra beobachtete, wie Freude das Antlitz ihrer Tochter erstrahlen ließ, als Randwulf of Greycliff die alte Tunika und die Beinkleider annahm. Nie hatte sie Serena so belebt gesehen, so strahlend vor Glück.
Es brach Calandra schier das Herz, diese Freude zu betrachten.
Natürlich wünschte sie für Serena nur das Beste, aber als Mutter wusste sie, dass ein Unglück auf ihre Tochter wartete. Calandra wusste dies genauso sicher, wie sie ihr eigenes törichtes Herz kannte. Sie musste mit ansehen, wie ihre eigenen Fehler der Vergangenheit sich nun bei Serena wiederholten – wie es so oft in der Geschichte der Fall war.
Sie konnte nicht viel unternehmen, um ihr Kind vor dem Schmerz zu bewahren, dem sie sich damit schon jetzt aussetzte. Sie hatte alles in ihrer Macht Stehende getan, um Serena zu beschützen, zu erziehen und auf die bösen Absichten der Menschen hinzuweisen, aber damit hatte sie nicht gerechnet. In all ihrer Fürsorge hatte Calandra nicht vorhersehen können, dass ein Mann wie Randwulf of Greycliff an ihre Küste gespült werden würde. Selbst in all ihren endlosen Albträumen hatte sie sich nicht ausmalen können, dass sich ihre schlimmsten Ängste letzten Endes bewahrheiteten.
Das Schicksal, dachte sie mit Wehmut. Offenbar konnte man ihm nicht entrinnen.
Das Rad der Fortuna war einmal in Gang gesetzt, und nun war es zu spät, Geschehnisse aufzuhalten, die zwangsläufig kommen würden.
Calandra hatte alles getan, um Serena den Weg ins Leben zu ebnen; jetzt musste ihre Tochter ihr Schicksal allein in die Hand nehmen.
10
Nach Rands Dafürhalten besaß dieser stille, bewaldete Landstrich eine eigenartige Aura. Es war Nacht, und Rand hielt vor der Hütte Wache. Er hatte es sich auf einem umgestürzten Baumstamm bequem gemacht und lehnte an einer dicken, weit ausladenden Eiche, die hoch in den Nachthimmel ragte. Nebelschwaden waren um Mitternacht vom Strand heraufgestiegen. Die feuchte Luft legte sich wie durchsichtiges Tuch auf seine Haut und hinterließ einen salzigen Geschmack auf seinen Lippen. Jenseits des Waldsaums erreichte die Flut die Küste mit einem klagenden Rauschen: ein hohles, leeres Geräusch, das tief in seinem Innern widerzuhallen schien.
Im Stillen schalt sich Rand für seine verdrießliche Stimmung. Selbstmitleid war fehl am Platze. Nie hatte er sich damit belastet, und auch jetzt würde er Gefühlen dieser Art keinen Raum
Weitere Kostenlose Bücher