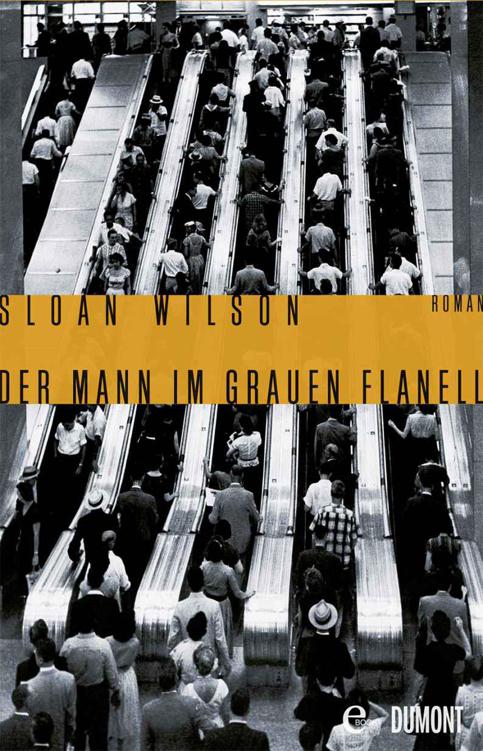![Der Mann im grauen Flanell: Roman (German Edition)]()
Der Mann im grauen Flanell: Roman (German Edition)
Schäbigkeiten zeugten von der Nachlässigkeit der Raths. Die Haustür war von einem Hund zerkratzt, der im Jahr davor überfahren worden war. Der Warmwasserhahn im Badezimmer tropfte. Nahezu alle Möbel mussten eigentlich nachgearbeitet, neu gepolstert oder gereinigt werden. Und außerdem war das Haus zu klein, hässlich und fast exakt wie die Häuser um sie herum.
Die Raths hatten das Haus 1946 gekauft, kurz nachdem Tom die Armee verlassen hatte und auf den Rat seiner Großmutter hin Assistent des Direktors der Schanenhauser-Stiftung wurde, einer Organisation, die ein älterer Millionär zur Finanzierung wissenschaftlicher Forschungen und der Künste eingerichtet hatte. Sie hatten sich gesagt, dass sie in dem Haus wahrscheinlich nur ein, zwei Jahre bleiben würden, bis sie sich ein besseres leisten könnten. Es dauerte fünf Jahre, bis ihnen bewusst wurde, dass die Kosten, drei Kinder großzuziehen, wahrscheinlich ebenso schnell stiegen wie Toms Gehalt bei einer wohltätigen Stiftung. Wären Tom und Betsy richtig vernünftig gewesen, dann hätte sie das veranlasst, das Haus wie verrückt zu streichen, doch es hatte den umgekehrten Effekt. Ohne viel darüber zu sprechen, empfanden beide das Haus zunehmend als Falle, und sie hatten nicht mehr Freude daran, es zu renovieren, als ein Häftling, die Stäbe seiner Zelle auf Hochglanz zu bringen. Beiden war bewusst, dass sie sich in dem Haus nicht eben großartig fühlten.
»Ich weiß nicht, was mit uns los ist«, sagte Betsy eines Abends. »Deine Arbeit ist doch wirklich gut genug. Wir haben drei nette Kinder, und viele wären froh, so ein Haus zu haben. Wir sollten nicht die ganze Zeit so unzufrieden sein.«
»Natürlich nicht!«, sagte Tom.
Ihre Worte klangen hohl. Es war seltsam zu glauben, dass dieses Haus mit dem Riss in Form eines Fragezeichens an der Wand und den Tintenflecken auf der Tapete womöglich das Ende ihres persönlichen Weges darstellte. Irgendwie musste etwas geschehen.
Tom grübelte über das Haus an jenem Tag Anfang Juni 1953, als ein Freund namens Bill Hawthorne die Möglichkeit einer Stelle bei der United Broadcasting Corporation erwähnte. Tom war beim Mittagessen mit einer Gruppe Bekannter im Golden Horseshoe, einem kleinen Restaurant mit Bar in der Nähe des Rockefeller Center.
»Wie ich höre, wird bald eine neue Stelle in unserer Public-Relations-Abteilung geschaffen«, sagte Bill, der bei der United Broadcasting Werbetexter war. »Ich glaube ja, jeder von euch wäre verrückt, wenn er das annehmen würde, aber wenn jemand Interesse hat, da wäre sie …«
Tom verlagerte seine langen Beine unterm Tisch und rutschte mit seinem mächtigen Körper unruhig auf dem Stuhl herum. »Was wird denn da gezahlt?«, fragte er beiläufig.
»Keine Ahnung«, sagte Bill. »Irgendwas zwischen acht- und zwölftausend, würde ich sagen, je nachdem, wie gut du feilschen kannst. Willst du’s versuchen, sag fünfzehn. Ich möchte einmal erleben, dass einer diese Schweine so richtig rannimmt.«
In jenem Sommer war es Mode, sich zynisch über seinen Arbeitgeber zu äußern, und die PR -Leute waren die zynischsten von allen.
»Kannst ihn haben«, sagte Cliff Otis, ein junger Texter bei einer großen Werbeagentur. »Die Konkurrenz da wäre mir wirklich zu hart.«
Tom blickte in sein Glas und sagte nichts. Vielleicht könnte ich ja auf zehntausend im Jahr kommen, dachte er. Wenn ich das schaffen würde, könnten Betsy und ich vielleicht ein besseres Haus kaufen.
2
Als Tom an jenem Abend in Westport aus dem Zug stieg, stand er in einer Schar Männer und blickte zu der Ecke des Bahnhofs hin, wo Betsy in der Regel auf ihn wartete. Sie war da, und unwillkürlich beschleunigte er bei ihrem Anblick die Schritte. Nach beinahe zwölf Ehejahren hatte er sich noch immer nicht ganz an sein Glück gewöhnt, so eine hübsche Frau bekommen zu haben. Obwohl ihre hellbraunen Haare, wie jetzt, ein wenig zerzaust waren, erschien sie ihm wunderschön. Das etwas knittrige baumwollene Hauskleid, das sie so unschuldig trug, betonte ihre schlanke Taille und die gleichwohl üppige Figur sehr vorteilhaft, und auch wenn sie ein wenig müde wirkte, war ihr Lächeln hell und jugendlich, als sie ihm zuwinkte. Weil er es so ehrlich empfand, war er immer versucht, ihr zu sagen: »Wie schön du bist!«, wenn er sie sah, nachdem er den Tag über weg gewesen war, doch er sagte es nicht, weil er vor langer Zeit gelernt hatte, dass sie vielleicht die einzige Frau der Welt war, die solche
Weitere Kostenlose Bücher