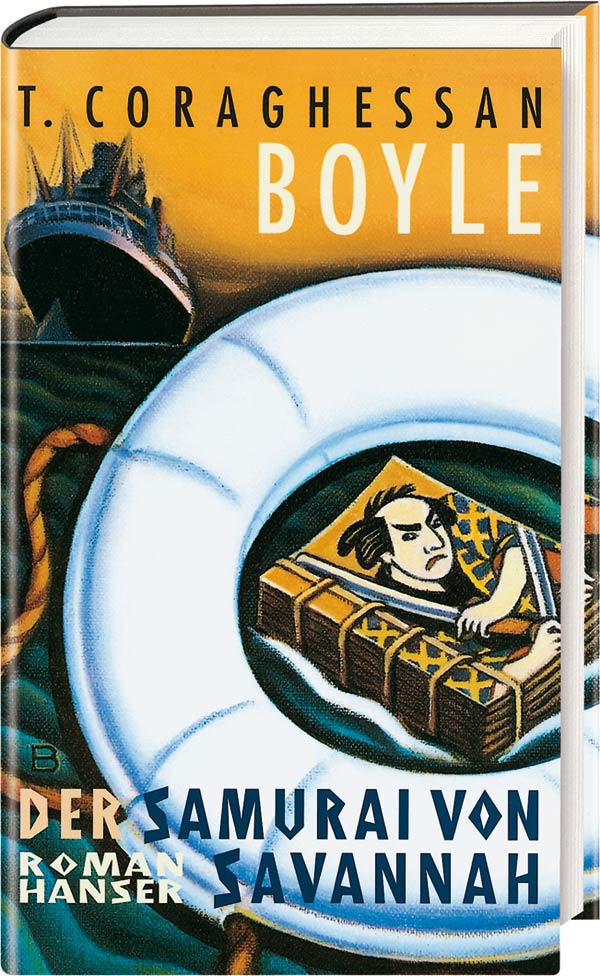![Der Samurai von Savannah]()
Der Samurai von Savannah
fünfzehn.«
Zehn Minuten später stand Roy mit seinem Pritschenwagen und einem Bootsanhänger vor der Tür. Auf dem Anhänger war ein langes Boot mit flachem Kiel festgemacht. Auf dem Bug stand Pequod II – einer von Roys kleinen Scherzen. »Morgen«, sagte Roy lakonisch, grinste breit und reichte Saxby eine Frühstückstüte von HARDEE’S und einen Styroporbecher mit schwarzem Kaffee.
Saxby hätte den Kofferraum des Mercedes schon in diesem Augenblick aufklappen können – er tat es sogar beinahe und verfluchte sich später selbst, weil er dem Impuls widerstanden hatte –, entschied sich aber, es sein zu lassen. Wenn er seine Stiefel, die Fallen, die O2-Flasche und den Rest herauszerrte und das ganze Zeug auf den Pritschenwagen umlud, würden sie damit nur wertvolle Zeit verlieren, und er wollte jetzt unbedingt los. Außerdem wäre es ohnehin besser, er hätte sein eigenes Auto dabei, falls er doch einen oder zwei Tage im Sumpf bleiben musste. Also nahm er den Kaffee und die Tüte mit dem Imbiss entgegen und zuckte die Achseln. »Am besten, ich fahr dir einfach hinterher«, sagte er. »In Ordnung?«
Bis Fargo lag ein gespenstischer, bleicher Dunst dicht über der Straße, und als sie auf die Landstraße Nr. 177 einbogen, die direkt in den Sumpf führte, wurde dieser Dunst zu Nieselregen. Saxby hörte das Geräusch der Reifen auf der nassen Straße und sah vor sich das Boot auf dem Anhänger hin und her schwanken. Er verspürte einen tiefen Frieden in sich, fühlte sich gelassen und eins mit der Welt. Rehe standen wachsam neben der Straße, watende Wasservögel stießen den Schnabel ins Wasser und breiteten die großen Schwingen zum Abflug aus. Bald würde er finden, was er suchte, das wusste er.
Das Nieseln ging wieder in Nebel über, der sich noch verdichtete, und dann waren sie am Ziel. Er folgte Roy über den Parkplatz vor dem Touristenzentrum und blieb vor der schmalen Rampe des Landungsstegs hinter ihm stehen. Auf der einen Seite war der ausgebaggerte und verbreiterte Teich, in dem die Mietboote dümpelten, auf der anderen begann der schmale Wasserlauf, der zu Billy’s Lake und in das sich ständig wandelnde Labyrinth von Kanälen führte, die sich durch den Sumpf schlängelten. Jetzt nieselte es wieder, und die Wolken hingen als trübe, metallische Klumpen knapp über den Baumwipfeln. Bis auf eine Handvoll Angler, die unter leisem, erwartungsvollem Raunen ihre Boote beluden, und die Häher und Spottdrosseln, die einander abwechselnd in den Bäumen beschimpften, war kein Laut zu hören. Das torfgesättigte, lauwarme Wasser hatte die Farbe von frisch gebrühtem Tee.
Saxby stand neben dem Mercedes und sah zu, wie Roy den Anhänger langsam rückwärts auf die Rampe hinuntersetzte. Als der Anhänger im Wasser stand, schaltete Roy den Motor ab, zog die Handbremse fest und stieg aus, um das Boot zu Wasser zu lassen, während Saxby zum Kofferraum des Mercedes schlenderte, um seine Sachen zu holen. Den Sauerstoff und die Plastiktüten würde er erst später brauchen, wenn er mit nach Hause nahm, wovon er hoffte, dass es der Grundstock seiner Barschzucht werden würde, aber er dachte an seine hüfthohen Stiefel, die Reusen und Kescher, und auch an das kleine Zehn-Meter-Treibnetz, das ihm in halbwegs freiem Wasser vielleicht von Nutzen sein könnte. Er hatte den Kofferraum nicht mehr geöffnet, seitdem er ihn vor gut zwölf Stunden hastig vollgeladen hatte, doch als er jetzt den Schlüssel ins Schloss steckte, sah er seinen Inhalt vor sich und stellte sich vor, wie die ganze Ausrüstung sauber im Laderaum von Roys Boot verstaut sein und sie beide mit kräftigen, leisen Paddelschlägen dahingleiten würden. Das Schloss nahm den Schlüssel auf. Der Schlüssel drehte sich im Schloss.
Ein ganz alltäglicher Vorgang.
EIN DSCHUNGEL
Was war nur mit ihr los? Was stimmte nicht mit ihr? Wo war die visionäre Autorin, die morgens mit unbeugsamem Willen erwachte, auf das Frühstück verzichtete, um sofort durch den nachtfeuchten Wald zum Nonnenkloster ihres Studios zu streben, ans Kreuz ihrer Kunst? Ruth wusste es nicht. Sie wusste nur, dass sie sich ebenso erschöpft fühlte wie damals als Teenager, als sie am Pfeiffer’schen Drüsenfieber erkrankt war. Sie hatte Kopfschmerzen – es kam ihr vor, als hätte sie schon seit Tagen, Wochen, ja ihr halbes Leben lang Kopfschmerzen –, und sie bewegte sich so zaghaft, als wären ihre Gliedmaßen nicht richtig am Körper befestigt. Vielleicht hatte sie sich irgendetwas
Weitere Kostenlose Bücher