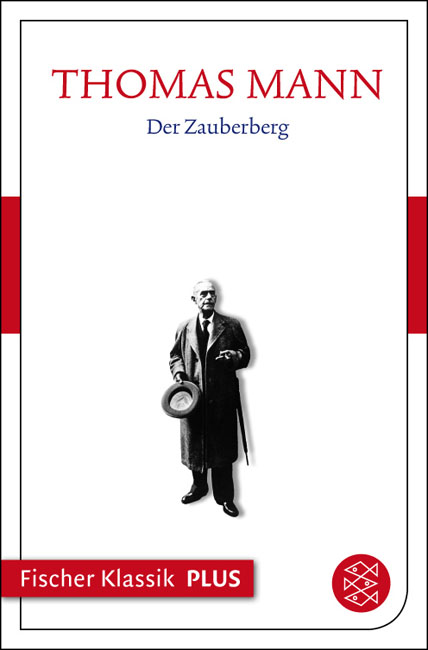![Der Zauberberg]()
Der Zauberberg
den vielfach in kurze Stückchen geteilten und in seiner feststehenden Einförmigkeit weder kurz- noch langweiligen Normaltag, der immer derselbe war. Morgens trat nach mächtigem Anklopfen der Bademeister herein, ein nerviges Individuum namens Turnherr, mit aufgerollten Hemdärmeln, hochgeäderten Unterarmen und einer gurgelnden, schwer behinderten Sprechart, der Hans Castorp, wie alle Patienten, mit seiner Zimmernummer anredete und ihn mit Alkohol abrieb. {288} Nicht lange nach seinem Abgang erschien Joachim, fertig angezogen, um Guten Morgen zu sagen, nach seines Vetters Sieben-Uhr-früh-Temperatur zu fragen und seine eigene mitzuteilen. Während er drunten frühstückte, tat Hans Castorp, sein Plumeau im Rücken, mit dem Appetit, den eine neue Lebenslage erzeugt, dasselbe –, kaum gestört durch den geschäftig-geschäftsmäßigen Einbruch der Ärzte, die um diese Zeit den Speisesaal passiert hatten und ihren Rundgang durch die Zimmer der Bettlägrigen und Moribunden im Geschwindschritt zurücklegten. Den Mund voll Eingemachtem, bekundete er, »schön« geschlafen zu haben, sah über den Rand seiner Tasse hin zu, wie der Hofrat, der seine Fäuste auf die Platte des Mitteltisches stemmte, rasch die dort aufliegende Fiebertabelle prüfte, und erwiderte gleichmütig gedehnten Tones den Morgengruß der Abziehenden. Dann zündete er sich eine Zigarette an und sah Joachim schon von seinem morgentlichen Dienstgang wieder zurückkehren, wenn er kaum gedacht hatte, daß er fortgegangen sei. Wieder plauderten sie dies und das, und der Zeit-Zwischenraum bis zum zweiten Frühstück – Joachim hielt Liegekur unterdessen – war so kurz, daß selbst ein ausgemachter Hohlkopf und Geistesarmer es nicht zur Langenweile gebracht haben würde, – während doch Hans Castorp an den Eindrücken seiner ersten drei Wochen hier oben reichlich zu zehren, auch seine gegenwärtige Lebenslage und was etwa daraus werden mochte, innerlich zu bearbeiten hatte und der beiden dicken Bände einer illustrierten Zeitschrift kaum bedurft hätte, die, der Anstaltsbibliothek entstammend, auf seinem Nachttisch lagen.
Nichts anderes gilt für die Zeitspanne, während der Joachim seinen zweiten Gang nach Platz Davos absolvierte, ein leichtes Stündchen. Er sprach dann wieder vor bei Hans Castorp und erzählte von dem und jenem, was ihm im Spazieren auffällig geworden, stand oder saß einen Augenblick am Krankenbette, {289} bevor er in die Mittagsliegekur ging, – und wie lange dauerte die? Nur wieder ein Stündchen! Man hatte kaum, die Hände hinter dem Kopf gefaltet, ein wenig zur Decke geblickt und einem Gedanken nachgehangen, so dröhnte das Gong, das die nicht Bettlägrigen und Moribunden aufforderte, sich zur großen Mahlzeit instandzusetzen.
Joachim ging, und es kam die »Mittagssuppe«: ein einfältig symbolischer Name für das, was kam! Denn Hans Castorp war nicht auf Krankenkost gesetzt, – warum auch hätte man ihn darauf setzen sollen? Krankenkost, schmale Kost war auf keine Art indiziert bei seinem Zustande. Er lag hier und zahlte den vollen Preis, und was man ihm bringt in der stehenden Ewigkeit dieser Stunde, das ist keine »Mittagssuppe«, es ist das sechsgängige Berghof-Diner ohne Abzug und in aller Ausführlichkeit, – am Alltage üppig, am Sonntage ein Gala-, Lust- und Parademahl, von einem europäisch erzogenen Chef in der Luxushotelküche der Anstalt bereitet. Die Saaltochter, deren Amt es war, die Bettlägrigen zu versorgen, brachte es ihm unter vernickelten Hohldeckeln und in leckeren Tiegeln; sie schob den Krankentisch, der sich eingefunden, dies einbeinige Wunder von Gleichgewichtskonstruktion, quer über sein Bett vor ihn hin, und Hans Castorp tafelte daran wie der Sohn des Schneiders am Tischlein deck dich.
Kaum hatte er abgespeist, so kehrte auch Joachim zurück, und bis dieser in seine Loggia ging und die Stille der großen Liegekur sich über Haus »Berghof« senkte, war es soviel wie halb drei geworden. Nicht ganz, vielleicht; genau genommen wohl erst ein Viertel über zwei. Aber solche überzähligen Viertelstunden außerhalb runder Einheiten werden nicht mitgerechnet, sondern nebenbei verschlungen, wo großzügige Zeitwirtschaft herrscht, wie etwa auf Reisen, bei vielstündiger Bahnfahrt oder sonst in leerem, wartendem Zustande, wenn alles Streben und Leben aufs Hinbringen und Zurücklegen von Zeit {290} zurückgeführt ist. Ein Viertel über zwei Uhr – das gilt für halb drei; es gilt in Gottes Namen
Weitere Kostenlose Bücher