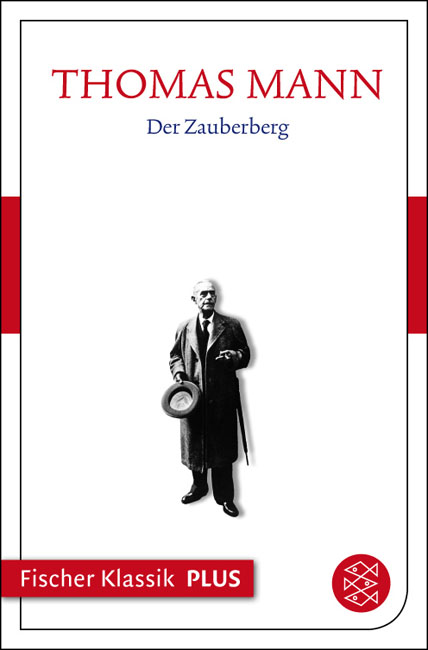![Der Zauberberg]()
Der Zauberberg
ihre Nichtzulassung geboten ist. Die christlichen Jahrhunderte waren völlig einig über die menschliche Unerheblichkeit der Naturwissenschaft. Lactantius, den Konstantin der Große zum Lehrer seines Sohnes wählte, fragte gerade heraus, welche Seligkeit er denn gewinnen werde, wenn er wisse, wo der Nil entspringt, oder was die Physiker vom {601} Himmel faseln. Das beantworten Sie ihm einmal! Wenn man die platonische Philosophie jeder anderen vorzog, so darum, weil sie sich nicht mit Naturerkenntnis, sondern mit der Erkenntnis Gottes abgab. Ich kann Sie versichern, die Menschheit ist im Begriff, zu diesem Gesichtspunkt zurückzufinden und einzusehen, daß es nicht Aufgabe wahrer Wissenschaft ist, heillosen Erkenntnissen nachzulaufen, sondern das Schädliche oder auch nur ideell Bedeutungslose grundsätzlich auszuscheiden und mit einem Worte Instinkt, Maß, Wahl zu bekunden. Es ist kindisch, zu meinen, die Kirche habe die Finsternis gegen das Licht verteidigt. Sie tat dreimal wohl daran, ein ›voraussetzungsloses‹ Streben nach Erkenntnis der Dinge, das heißt: ein solches, das sich der Rücksicht auf das Geistige, auf den Zweck der Heilserwerbung entschlägt, für strafbar zu erklären, und was den Menschen in Finsternis geführt hat und immer tiefer führen wird, ist vielmehr die ›voraussetzungslose‹, die aphilosophische Naturwissenschaft.«
»Sie lehren da einen Pragmatismus,« erwiderte Settembrini, »den Sie nur ins Politische zu übertragen brauchen, um seiner ganzen Verderblichkeit ansichtig zu werden. Gut, wahr und gerecht ist, was dem Staate frommt. Sein Heil, seine Würde, seine Macht ist das Kriterium des Sittlichen. Schön! Damit ist jedem Verbrechen Tür und Tor geöffnet, und die menschliche Wahrheit, die individuelle Gerechtigkeit, die Demokratie – sie mögen sehen, wo sie bleiben …«
»Ich bringe ein wenig Logik in Vorschlag«, versetzte Naphta. »Entweder Ptolemäus und die Scholastik behalten recht, und die Welt ist endlich in Zeit und Raum. Dann ist die Gottheit transzendent, der Gegensatz von Gott und Welt bleibt aufrecht, und auch der Mensch ist eine dualistische Existenz: das Problem seiner Seele besteht in dem Widerstreit des Sinnlichen und des Übersinnlichen, und alles Gesellschaftliche ist mit Abstand zweiten Ranges. Nur diesen Individualismus kann ich {602} als konsequent anerkennen. Oder aber Ihre Renaissance-Astronomen fanden die Wahrheit, und der Kosmos ist unendlich. Dann gibt es keine übersinnliche Welt, keinen Dualismus; das Jenseits ist ins Diesseits aufgenommen, der Gegensatz von Gott und Natur hinfällig, und da in diesem Falle auch die menschliche Persönlichkeit nicht mehr Kriegsschauplatz zweier feindlicher Prinzipien, sondern harmonisch, sondern einheitlich ist, so beruht der innermenschliche Konflikt lediglich auf dem der Einzel- und der gesamtheitlichen Interessen, und der Zweck des Staates wird, wie es gut heidnisch ist, zum Gesetz des Sittlichen. Eines oder das andere.«
»Ich protestiere!« rief Settembrini, indem er seine Teetasse dem Gastgeber mit ausgestrecktem Arm entgegenhielt. »Ich protestiere gegen die Unterstellung, daß der moderne Staat die Teufelsknechtschaft des Individuums bedeute! Ich protestiere zum drittenmal, und zwar gegen die vexatorische Alternative von Preußentum und gotischer Reaktion, vor die Sie uns stellen wollen! Die Demokratie hat keinen anderen Sinn, als den einer individualistischen Korrektur jedes Staatsabsolutismus. Wahrheit und Gerechtigkeit sind Kronjuwelen individueller Sittlichkeit, und im Falle des Konflikts mit dem Staatsinteresse mögen sie wohl sogar den Anschein staatsfeindlicher Mächte gewinnen, während sie in der Tat das höhere, sagen wir es doch: das überirdische Wohl des Staates im Auge haben. Die Renaissance der Ursprung der Staatsvergottung! Welche Afterlogik! Die Errungenschaften – ich sage mit etymologischer Betonung: die
Errungen
schaften von Renaissance und Aufklärung, mein Herr, heißen Persönlichkeit, Menschenrecht, Freiheit!«
Die Zuhörer atmeten aus, denn sie hatten die Luft angehalten bei Herrn Settembrinis großer Replik. Hans Castorp konnte sogar nicht umhin, mit der Hand, wenn auch zurückhaltenderweise, auf den Tischrand zu schlagen. »Brillant!« sagte er zwischen den Zähnen, und auch Joachim zeigte starke Befrie {603} digung, obgleich ein Wort gegen das Preußentum gefallen war. Dann aber wandten sich beide dem eben zurückgeschlagenen Interlokutor zu, Hans Castorp mit solchem Eifer,
Weitere Kostenlose Bücher