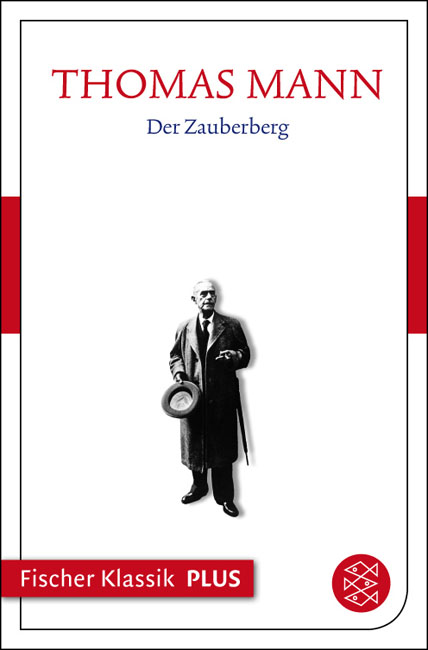![Der Zauberberg]()
Der Zauberberg
als Protestant zu gelten habe, erwiderte er: gerade das Wort »Staatsphilosoph« bekräftige, daß er im religiösen, wenn auch natürlich nicht im kirchlich-dogmatischen Sinn mit seiner Behauptung von Hegels Katholizität im Rechte sei.
Denn
(diese Konjunktion liebte Naphta ganz besonders; sie gewann etwas Triumphierend-Unerbittliches in seinem Munde, und seine Augen hinter den Brillengläsern blitzten auf, jedesmal, wenn er {668} sie einfügen konnte), denn der Begriff des Politischen sei mit dem des Katholischen psychologisch verbunden, sie bildeten eine Kategorie, die alles Objektive, Werkhafte, Tätige, Verwirklichende, ins Äußere Wirkende umfasse. Ihr gegenüber stehe die pietistische, aus der Mystik hervorgegangene, protestantische Sphäre. Im Jesuitentum, fügte er hinzu, werde das politisch-pädagogische Wesen des Katholizismus evident; Staatskunst und Erziehung habe dieser Orden immer als seine Domänen betrachtet. Und er nannte noch Goethe, der, im Pietismus wurzelnd und gewiß Protestant, eine stark katholische Seite besessen habe, nämlich kraft seines Objektivismus und seiner Tätigkeitslehre. Er habe die Ohrenbeichte verteidigt und sei als Erzieher ja beinahe Jesuit gewesen.
Mochte Naphta diese Dinge vorgebracht haben, weil er daran glaubte, oder weil er sie witzig fand, oder um seinem Zuhörer nach dem Munde zu reden, als ein Armer, der schmeicheln muß und wohl berechnet, wie er sich nützen, wie schaden kann: der Pater hatte sich um ihren Wahrheitswert weniger gekümmert, als um die allgemeine Gescheitheit, von der sie zeugten; das Gespräch hatte sich fortgesponnen, Leos persönliche Umstände waren dem Jesuiten bald bekannt gewesen, und die Begegnung hatte mit der Aufforderung Unterpertingers an Leo geschlossen, ihn im Pädagogium zu besuchen.
So hatte Naphta den Boden der Stella matutina betreten dürfen, deren wissenschaftlich und gesellschaftlich anspruchsvolle Atmosphäre vorstellungsweise längst seine Sehnsucht gereizt hatte; und mehr: es war ihm durch diese Wendung der Dinge ein neuer Lehrer und Gönner beschert worden, weit besser aufgelegt, als der vormalige, sein Wesen zu schätzen und zu fördern, ein Meister, dessen Güte, kühl ihrer Natur nach, auf Weltläufigkeit beruhte, und in dessen Lebenskreis einzudringen er größte Begierde empfand. Gleich vielen geistreichen Juden war Naphta von Instinkt zugleich Revolutionär und {669} Aristokrat; Sozialist – und zugleich besessen von dem Traum, an stolzen und vornehmen, ausschließlichen und gesetzvollen Daseinsformen teilzuhaben. Die erste Äußerung, welche die Gegenwart eines katholischen Theologen ihm entlockt hatte, war, obgleich sie sich rein analytisch-vergleichend gegeben hatte, eine Liebeserklärung an die römische Kirche gewesen, die er als eine zugleich vornehme und geistige, das heißt antimaterielle, gegenwirkliche und gegen-weltliche, also revolutionäre Macht empfand. Und diese Huldigung war echt und stammte aus seines Wesens Mitte; denn, wie er selbst auseinandersetzte, stand das Judentum kraft seiner Richtung aufs Irdisch-Sachliche, seines Sozialismus, seiner politischen Geistigkeit der katholischen Sphäre weit näher, war ihr ungleich verwandter, als der Protestantismus in seiner Versenkungssucht und mystischen Subjektivität, – wie denn also auch die Konversion eines Juden zur römischen Kirche entschieden einen geistlich zwangloseren Vorgang bedeutete, als die eines Protestanten.
Entzweit mit dem Hirten seiner ursprünglichen Religionsgemeinschaft, verwaist und verlassen, dazu voller Verlangen nach reinerer Lebensluft, nach Daseinsformen, auf die seine Gaben ihm Anrecht verliehen, war Naphta, der das gesetzliche Unterscheidungsalter ja längst erreicht hatte, zum konfessionellen Übertritt so ungeduldig bereit, daß sein »Entdecker« sich jeder Mühe überhoben sah, diese Seele, oder vielmehr diesen ungewöhnlichen Kopf für die Welt seines Bekenntnisses zu gewinnen. Schon bevor er die Taufe empfing, hatte Leo auf Betreiben des Paters in der »Stella« vorläufige Unterkunft, leibliche und geistige Versorgung, gefunden. Er war dorthin übergesiedelt, indem er seine jüngeren Geschwister mit größter Gemütsruhe, mit der Unempfindlichkeit des Geistesaristokraten der Armenpflege und einem Schicksal überließ, wie es ihrer minderen Begabung gebührte.
{670} Grund und Boden der Erziehungsanstalt waren weitläufig, wie ihre Baulichkeiten, die Raum für gegen vierhundert Zöglinge boten. Der Komplex umfaßte
Weitere Kostenlose Bücher