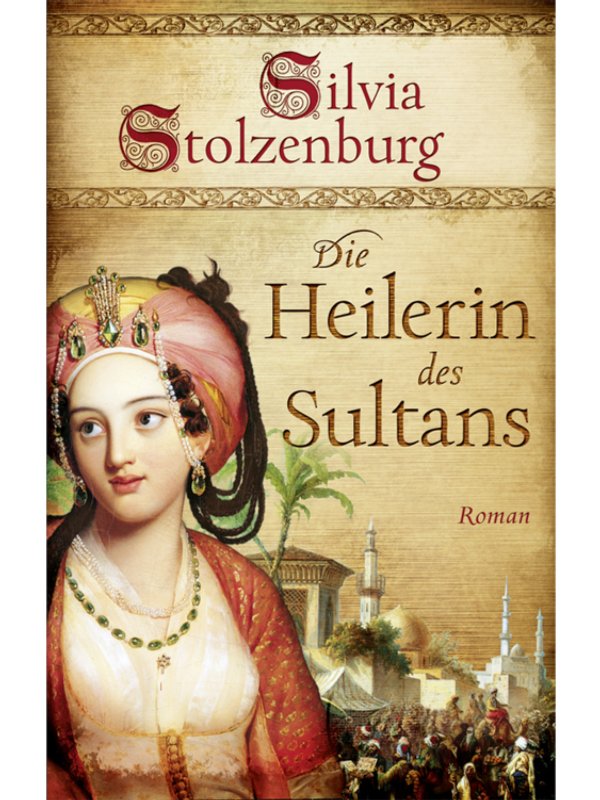![Die Heilerin des Sultans]()
Die Heilerin des Sultans
mit den Armen, um die
Wachen zu verscheuchen. »Geht weg.« Die Männer
wechselten hilflose Blicke. »Seid Ihr nicht in Begleitung Eurer
Zofen?«, fragte ihr Anführer lahm, da alles an Oliveras
Erscheinung sonderbar war. Nicht nur schien sie mitten in der Nacht
allein im Regen unterwegs zu sein, ihr Haar klebte nass und strähnig
in ihrer Stirn und das ehemals weiße Gewand war
schmutzverkrustet. Das einst schöne Gesicht wirkte verhärmt,
der Blick der blauen Augen leicht irre – ein Eindruck, der
durch den verschmierten Kohlestift verstärkt wurde. Sapphiras
Feindseligkeit verwandelte sich in Befremden. Was war mit der
hochfahrenden, berechnenden und dennoch so vollkommen liebreizenden
Frau geschehen, die alle Hofdamen mit Eifersucht erfüllt hatte?
Wo war die makellose Schönheit? Wo waren die Wortgewandtheit,
die Eleganz und die prunkvollen Kleider? Die Vogelscheuche, die vor
ihr im Regen stand, schwankte wie ein Grashalm im Wind und
vermittelte den Eindruck, durch den Schlamm gezogen worden zu sein.
»Ihr sollt mich in Ruhe lassen«, lallte die gar nicht
mehr vornehme Dame und ließ sich auf den Boden fallen, als habe
jemand die Schnüre durchschnitten, von denen sie aufrecht
gehalten wurde. Das nasse Gras gab ein schmatzendes Geräusch von
sich und Olivera begann, hysterisch zu kichern. Wenngleich es ihr
widerstrebte, näherte Sapphira sich der Frau, die Bülbüls
Leben zerstört hatte, und sah auf sie hinab. Trotz des Windes
und dem durchdringenden Geruch von Feuchtigkeit, nahm sie eine
Ausdünstung wahr, die Oliveras merkwürdiges Verhalten
erklärte. Sie war nicht nur betrunken, sondern vollkommen
berauscht. Das hysterische Kichern verwandelte sich in einen lang
gezogenen, klagenden Laut, der in einem Schluchzen erstickte. Trotz
der hässlichen Intrige, welche die Gemahlin des Sultans
gesponnen hatte, stieg Mitleid in Sapphira auf. Offenbar hatte der
Tod ihres ungeborenen Kindes Olivera über die Kante in den
Abgrund des Wahnsinns gestürzt.
Das
Schluchzen verstummte und Olivera hob den Kopf. Die glasigen Augen
blickten starr geradeaus, während ihre Lippen stumme Worte
formten. Mit einem Seufzen wandte Sapphira sich zu den verdatterten
Wachen um und sagte: »Helft mir, sie ins Darüssifa zu bringen. Sie ist krank.«
Einen Moment lang wirkte es, als wollte der Anführer ihr
widersprechen, doch dann nickte er seinen Männern zu und ging
mit einer Laterne voraus. Wenige Minuten später ruhte Olivera in
einem Bett. Kaum hatte Sapphira sie von den durchnässten
Kleidern befreit, schloss sie die Augen und begann kurz darauf, wenig
damenhaft zu schnarchen. Mit einem Naserümpfen zog Sapphira eine
Bettpfanne heran – davon überzeugt, dass Olivera sich
früher oder später übergeben würde. Obgleich ein
Teil von ihr sich über den jämmerlichen Zustand der
einstigen Rivalin freuen wollte, gewann ihr Mitgefühl die
Oberhand und sie deckte die Gemahlin des Sultans zu. Wie schrecklich
es sein musste, ein Kind durch die Hand des Vaters zu verlieren,
konnte sie sich nicht einmal vorstellen. Ihre Abneigung gegen die
arglistige Ränkeschmiedin hob erneut das Haupt. Andererseits
hatte Olivera Strafe verdient. Sie löste den Blick von dem
gezeichneten Gesicht und zog die Kapuze wieder über den Kopf.
Sie würde sich morgen weiter um sie kümmern. Jetzt brauchte
sie erst einmal Schlaf.
Kapitel 66
Konstantinopel,
Winter 1401
Trotz der
trüben Witterung konnte Johannes Palaiologos deutlich die
Schiffe der osmanischen Marine erkennen. Mit mächtigen
Geschützen bestückt, schossen diese auf alles, was sich
ihnen unerlaubt näherte, und Johannes hatte bereits mehr als ein
venezianisches Handelsschiff sinken sehen. Seit Beginn des neuen
Jahres hatte Bayezid die Belagerung der Stadt verschärft und
stürmte mit einer Wut gegen die Mauern an, die Johannes Angst
einjagte. Nachdem er sich mehrmals heimlich mit Matthäus –
dem Patriarchen Konstantinopels – getroffen hatte, war ihm
klar, dass ihm von dieser Seite kein Widerstand drohte. Allerdings
hatte der Kirchenmann ihm auch unmissverständlich zu verstehen
gegeben, dass er nicht vorhatte, Johannes bei einem Umsturz zu
helfen. Er zog den pelzverbrämten Mantel enger um die Schultern
und reckte die Nase in den eisigen Wind. Grau-weiße
Wolkenfetzen jagten sich über einen Himmel, der aussah wie ein
zerklüftetes Bergmassiv. Trotz der Kälte schritt er weiter
an der Mauer entlang, bis er einen Aussichtspunkt erreichte, von dem
aus man das Goldene Horn
Weitere Kostenlose Bücher