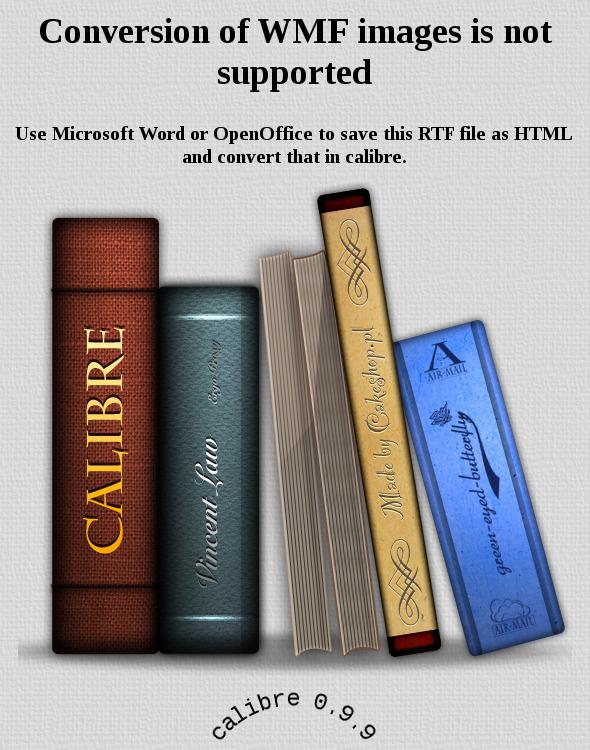![Die Liebe in den Zeiten der Cholera]()
Die Liebe in den Zeiten der Cholera
müßte. Er wußte es. Fermina Daza gab dem Steward Anweisung, sie so lange schlafen zu lassen, wie sie wollte, und als sie aufwachte, stand auf dem Nachttisch eine Vase mit einer noch vom Tau benetzten weißen Rose, und daneben lag ein Brief Florentino Arizas mit so vielen Seiten, wie ihm, seitdem er sich von ihr verabschiedet hatte, zu füllen gelungen war. Es war ein gelassener Brief, der nur die Stimmung beschreiben wollte, die den Verfasser seit der vergangenen Nacht erfüllte: lyrisch wie die anderen Briefe, rhetorisch wie alle, doch erfüllt von Wirklichkeit. Fermina Daza las ihn und schämte sich dabei etwas über den wilden Galopp ihres Herzens. Der Brief endete mit der Bitte, dem Steward Bescheid zu geben, sobald sie fertig sei, da der Kapitän sie auf der Brücke erwarte, um ihnen den Dampfer zu erklären. Um elf Uhr war sie bereit, gebadet und nach Blurrienseife duftend, sie trug ein schlichtes Witwenkleid aus dünner grauer Baumwolle und hatte sich von der Nacht erholt. Sie bestellte bei dem in makelloses Weiß gekleideten Steward des Kapitäns ein einfaches Frühstück, trug ihm jedoch nicht auf, man solle sie abholen. Sie machte sich geblendet vom wolkenlosen Himmel allein auf den Weg und traf Florentino Ariza, der sich mit dem Kapitän unterhielt, auf der Brücke. Er wirkte verändert, nicht nur weil sie ihn jetzt mit anderen Augen sah, sondern weil er sich tatsächlich verändert hatte. Statt seiner lebenslangen Trauerkleidung trug er nun bequeme weiße Schuhe, eine Leinenhose und ein kurzärmeliges Leinenhemd mit offenem Kragen und einer Brusttasche, auf die sein Monogramm gestickt war. Dazu paßte seine ebenfalls weiße Schottenmütze, und an der ewigen Brille des Kurzsichtigen hatte er getönte Gläser befestigt. Ganz offensichtlich war alles neu und gerade erst für den Zweck der Reise gekauft worden, mit Ausnahme des abgewetzten braunen Ledergürtels, den Fermina Daza sofort, wie ein Haar in der Suppe, bemerkte. Als sie den Mann sah, der sich so offenkundig für sie eingekleidet hatte, konnte sie nicht verhindern, daß ihr brennende Röte ins Gesicht stieg. Sie war verwirrt, als sie ihn begrüßte, und ihn verwirrte ihre Verwirrung. Das Bewußtsein, sich wie ein Liebespaar zu benehmen, verwirrte beide noch mehr, und das Bewußtsein, verwirrt zu sein, verwirrte beide dermaßen, daß es Kapitän Samaritano vor Mitgefühl bebend registrierte. Er half ihnen über die Verlegenheit hinweg, indem er ihnen zwei Stunden lang die Bedienung des Steuers und der Maschinen des Dampfers erklärte. Sie fuhren langsam auf einem Fluß ohne Ufer dahin, der sich am Horizont zwischen kahlen Sandbänken verlor. Doch anders als das aufgewühlte Wasser im Mündungsgebiet war der Strom hier langsam und durchsichtig und von metallischem Glanz unter der gnadenlosen Sonne. Fermina Daza hatte den Eindruck, ein Delta voller Sandinseln läge vor ihr.
»Das ist das wenige, was uns vom Fluß noch bleibt«, sagte der Kapitän.
Florentino Ariza war in der Tat verwundert über die Veränderungen und sollte es am nächsten Tag noch mehr sein, als es abermals mühsamer wurde, voranzukommen, und er einsehen mußte, daß der Magdalena, einer der großen Ströme der Welt, nur noch ein Trugbild seiner Erinnerung war. Kapitän Samaritano erklärte ihnen, wie das planlose Abholzen den Fluß innerhalb von fünfzig Jahren erledigt hatte: Die Schiffskessel hatten dieses Urwalddickicht aus kolossalen Bäumen verschlungen, das Florentino Ariza auf seiner ersten Fahrt noch als bedrohlich empfunden hatte. Fermina Daza würde die Tiere ihrer Träume nicht mehr sehen: Die Jäger der Gerbereien von New Orleans hatten die Kaimane ausgerottet, die sich einst stundenlang mit offenem Rachen an den Flußufern totgestellt hatte , um die Schmetterlinge zu überlisten, die plappernden Papageien und die langschwänzigen Affen mit ihrem Gekecker waren, als die Laubkronen dahinschwanden, allmählich ausgestorben, und den Seekühen, die ihre Jungen an den großen Zitzen säugten und mit untröstlichen Frauenstimmen auf den Sandbänken klagten, hatten die Mantelgeschosse der Sonntagsjäger ein Ende bereitet. Kapitän Samaritano hegte fast mütterliche Gefühle für die Seekühe, sie kamen ihm vor wie vornehme Damen, die wegen einer Liebeseskapade verdammt worden waren, und er glaubte an die Legende, daß sie im Tierreich die einzigen Weibchen ohne dazugehörige Männchen waren. Er war stets eingeschritten, wenn von Bord aus auf sie geschossen worden war, wie
Weitere Kostenlose Bücher