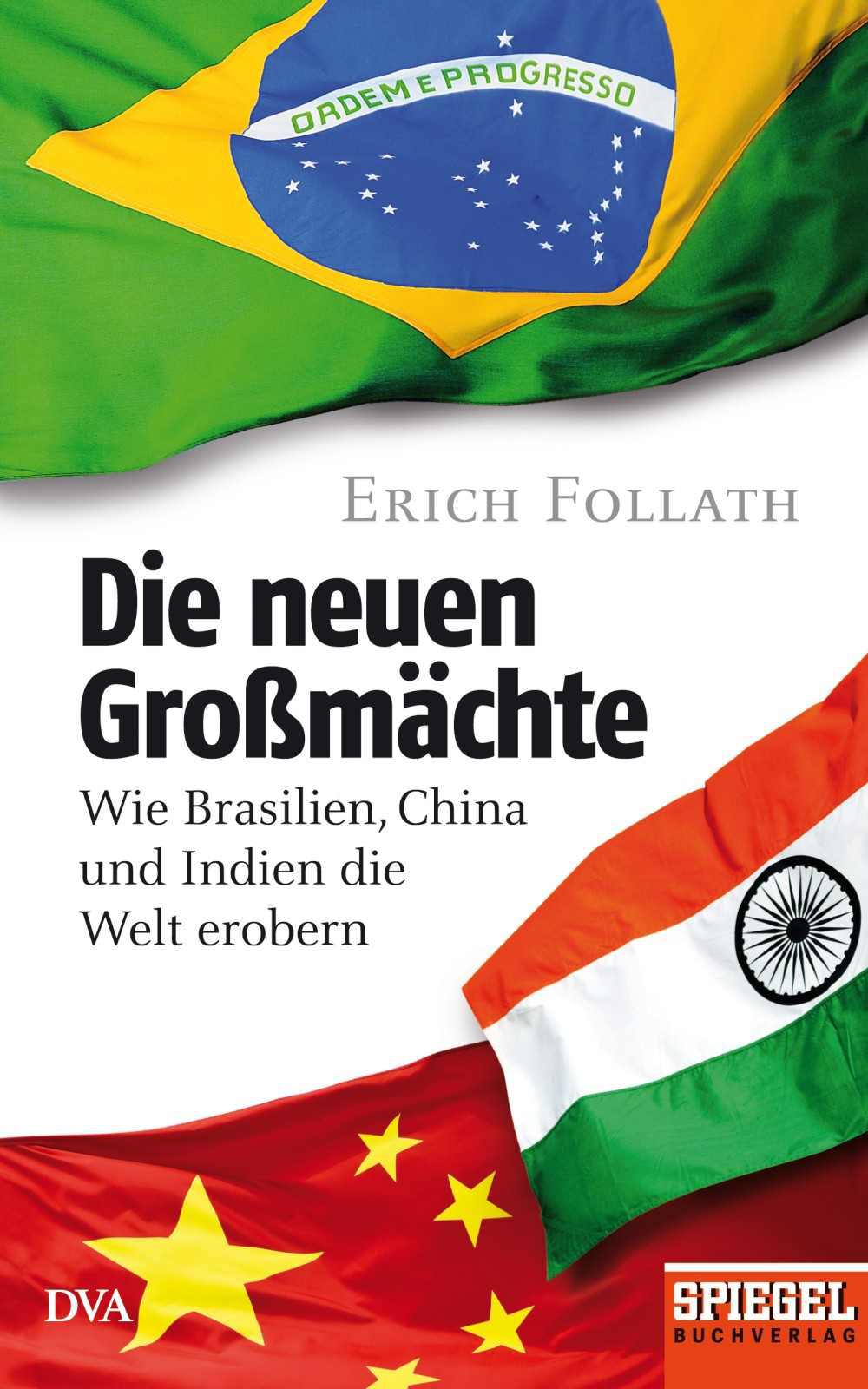![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
rund um die Uhr erwartet: Sie setzt Kabinettssitzungen am späten Freitagnachmittag an, wenn praktisch das ganze Land schon im Wochenende ist. Sie fordert Powerpoint-Präsentationen ihrer Minister schon montagsfrüh um halb acht. Die Redewendungen »geht nicht« und »vielleicht morgen« setzt sie, wie Kabinettskollegen erzählen, auf den Index. Sie wirkt äußerst angespannt, aber vital. Die Strahlentherapie gegen Krebs, der sie sich 2010 unterziehen musste, hat offensichtlich angeschlagen, auch ihre dichten Haare sind nachgewachsen.
Dilma Rousseff geht der Ruf voraus, lieber mit Frauen als mit Männern zusammenzuarbeiten. Sie sagt, es gehe ihr »nur um Kompetenz«. Aber richtig ist, dass sie mehr als ein Drittel aller Ministerposten mit Frauen besetzt. Kabinettschefin wird Gleisi Hoffmann, eine kühl kalkulierende deutschstämmige Managerin. Am Anfang meinen noch manche, die Blondine als »Dilmas Barbie« verspotten zu können, intern wird sie überall ehrfürchtig »die Preußin« genannt. Das Planungsministerium leitet Miriam Belchior, für die Beziehungen zwischen Regierung und Kongress zuständig ist Ideli Salvatti, als Pressechefin fungiert Helena Chagas. Die offizielle Quotenregelung, die Frauen 30 Prozent aller Abgeordneten-, Gouverneurs- und Bürgermeisterstellen sichert, wird in der Regierung mit zehn Ministerinnen überschritten.
Im inneren Zirkel der Macht ist Präsidialamtschef Gilberto Carvalho der einzige Mann. Er hat schon acht Jahre unter ihrem Vorgänger Lula gedient und kennt sich bestens aus im Labyrinth der Macht. Für Rousseffs Damenriege ist er eine Art großer Bruder. Zu ihm kommen sie, wenn sie sich von der Chefin zu Unrecht gerüffelt fühlen und Trost brauchen. »Ich bin für den klassischen weiblichen Part in der Regierung zuständig«, sagt er mit einem Augenzwinkern. Der Lula-Vertraute hat sich nach anfänglichem Misstrauen dem Dilma-Fanclub angeschlossen – zumindest äußerlich. Manche glauben, das sei kalkuliert, seine politische Überlebensstrategie. Er sehe manches an der Regierungschefin auch sehr kritisch: ihre oft beleidigende kurz angebundene Art, der arrogante Glauben, immer auf dem richtigen Weg zu sein, das Abbürsten gegenteiliger Meinungen. Rousseff hat jedenfalls aus dem lateinamerikanischen Macho-Land fast schon ein Matriarchat gemacht. Ende 2011 wählt die brasilianische Presse Dilma Rousseff voller Bewunderung zum »Mann des Jahres« – kaum vorstellbar, dass es schon 18 Monate später zu Massenprotesten im Land kommt.
»Wenn sie die Wahl hat zwischen zwei gleich qualifizierten Personen, zieht sie immer die Frau vor«, hat ihr Kabinettschef einmal gesagt. Aber sie kann sehr wohl auch Männern zum Karrieresprung verhelfen, wenn sie das denn richtig findet und für ihr Land als nützlich erachtet. So geschehen bei der Neubesetzung des wichtigen Chefpostens bei der Welthandelsorganisation ( WTO ) im Mai 2013. Brasiliens Präsidentin tat alles, um ihren Landsmann Roberto Carvalho de Azevêdo gegen den Willen der USA und der EU durchzusetzen – und schaffte das nach langem Ringen auch.
Dabei zeigten sich die neuen Allianzen, die künftig immer mehr die Weltpolitik bestimmen werden: Brasília konnte die Mehrzahl der afrikanischen Staaten hinter sich bringen, vor allem aber China, Indien und Russland, ihre einflussreichen Mitstreiter in der BRICS -Gemeinschaft. Washington, Brüssel, Berlin, London und Paris hatten sich vehement für den ihnen genehmen mexikanischen Gegenkandidaten ausgesprochen – ihr Scheitern ist ein Beleg mehr für die schwindende Dominanz der »alten« Industriestaaten, das Aufkommen der Schwellenländer und neuen Großmächte. Rousseff nahm die Ernennung des 55-jährigen Karrierediplomaten Azevêdo »mit Genugtuung« auf, sagte, die Welthandelsorganisation als solche habe gewonnen. Ihr Außenminister Antonio Patriota konnte es sich aber nicht verkneifen, von einem »Sieg für Brasilien« zu sprechen. Die WTO dürfte in den nächsten Jahren wichtige Weichen für den internationalen Geschäftsverkehr stellen, sie soll über dessen Regeln bestimmen und sie überwachen. In einigen Bereichen hat sich der Neue klar für eine Liberalisierung ausgesprochen – etwa wenn er gegen US -amerikanische Subventionen für Baumwolle oder EU -Agrarhilfen für Zuckerproduzenten wettert. Wenn es um die brasilianische Wirtschaft geht, hat Azevêdo allerdings auch schon protektionistische Maßnahmen befürwortet. Nun fühlt er sich nach eigenen Worten »zur
Weitere Kostenlose Bücher