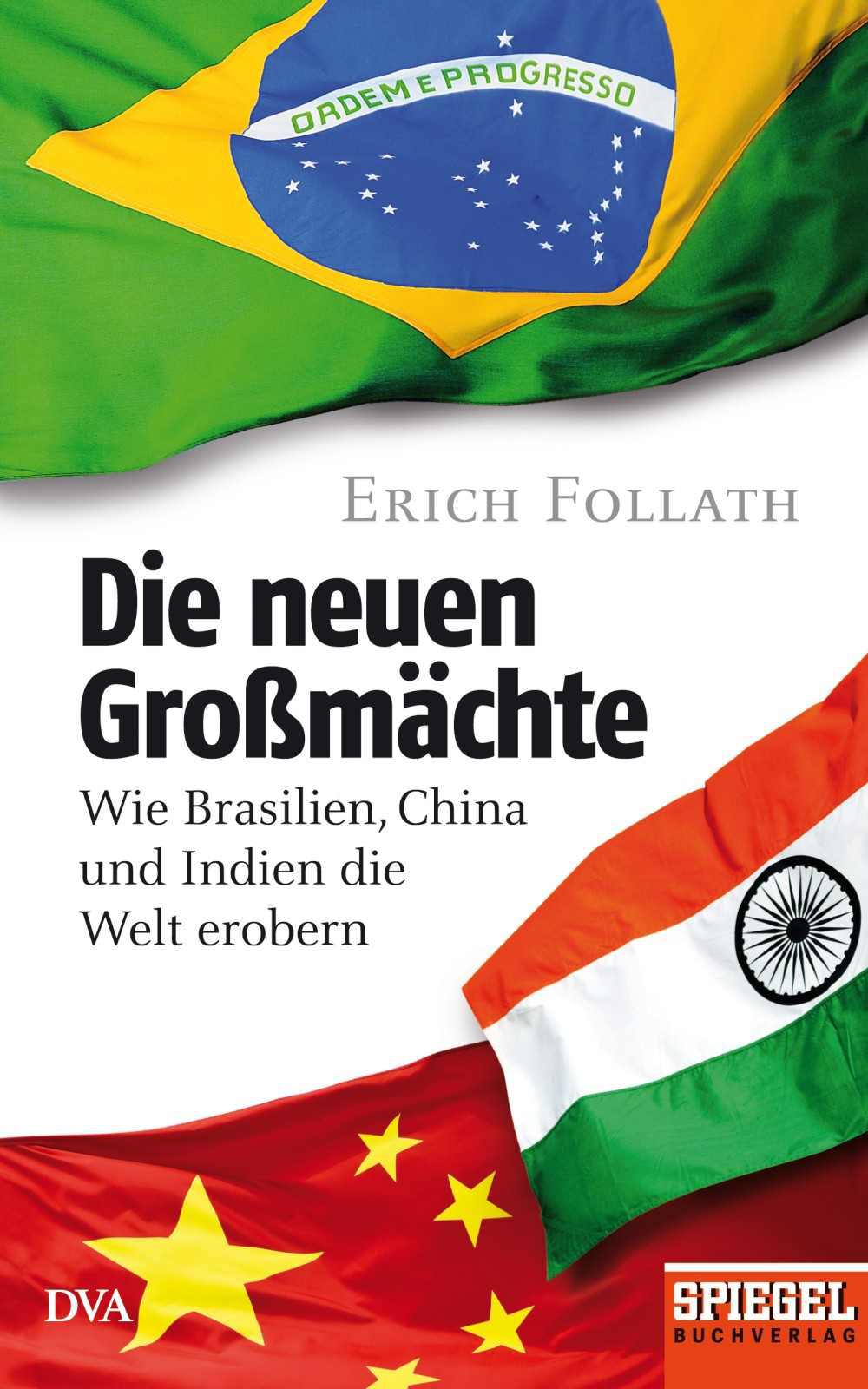![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
Neutralität verpflichtet« und will neuen Schwung in die Doha-Runde zur Liberalisierung des Welthandels bringen, die nicht zuletzt an den Vetowünschen Indiens gescheitert waren. Eine gewaltige Aufgabe, da doch die USA und Europa begonnen haben, auf bilaterale Abkommen zu setzen und die WTO zur Seite zu drängen.
Für Brasilien war Azevêdos Ernennung schon der zweite große internationale diplomatische Triumph innerhalb relativ kurzer Zeit: José Graziano da Silva leitet seit Januar 2012 die UNO -Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation in Rom. In Zeiten der weltweiten Verknappung von Lebensmitteln und der finanziellen Spekulationen mit ihnen ist das eine enorm wichtige Funktion. Es sei eben wichtig, mit allen Nationen einen guten Gesprächskontakt zu haben, mit Washington wie mit Peking, mit Schwellen- wie mit Entwicklungsländern, sagte die Präsidentin. Sie wollte damit wohl ausdrücken: Seht her, ihr in den USA und Europa, ihr seid mit eurer Politik »verdächtig«, ihr habt das nicht. Dennoch wird man Rousseff nicht eine beliebige Außenpolitik oder gar Liebedienerei vorwerfen können. Sie handelt in dieser Beziehung auch nüchterner als ihr von der eigenen Bedeutung manchmal allzu überzeugter Vorgänger. Sie glaubt nicht wie Lula, Iran durch die Macht der brasilianischen Diplomatie vom Bau der Bombe abbringen zu können. Als Präsident Mahmud Ahmadinedschad im Jahr 2012 seine Südamerika-Reise antrat, gewährte sie dem Provokateur der internationalen Politik nicht einmal einen Termin. Aber sie zeigte auch mit unübersehbaren Gesten, wie sehr sich in ihren Augen die Prioritäten Brasiliens und die Machtverhältnisse in der Welt geändert haben: Ihr erster Auslandsbesuch als Präsidentin führte sie in die Volksrepublik China, nicht in die Vereinigten Staaten. Und Rousseff hielt es für selbstverständlich, dass US -Präsident Barack Obama zuerst seine Aufwartung in Brasília machte, bevor sie dann zum Gegenbesuch nach Washington aufbrach.
Den einzigen Hauch von Sentimentalität, den sich die Präsidentin bisher gegönnt hat, war ein Trip nach Bulgarien, in das Land ihrer Ahnen. Sie reiste auch nach Gabrowo, in die Geburtsstadt ihres Vaters. Die sonst so nüchterne Politikerin musste sich bei der Reise zu ihren Wurzeln tatsächlich einmal die Tränen aus den Augen wischen. Sie fasste sich aber rasch wieder und strich aus dem Gesprächsprotokoll mit den lokalen Politikern einen Satz der Rührung (»Seit ich hier bin, fühle ich mich von Liebe umgeben«). Emotionen sind ihr unangenehm, sie betrachtet so etwas offensichtlich als Zeichen der Schwäche. Ihr altes Foltergefängnis in São Paulo, inzwischen zu einem mahnenden Museum umgebaut, hat sie nie besucht.
Einen besonderen Schwerpunkt in der Außenpolitik legt Brasiliens Staatschefin auf Afrika. Sie kämpft da teilweise an der Seite der BRICS -Partner China und Indien gegen eine jahrzehntelange Vorherrschaft des Westens, teilweise auch in Konkurrenz mit den anderen neuen Weltmächten. Und sie glaubt, Brasilien könnte auf dem »Schwarzen Kontinent« zum Vorreiter werden, den Wettlauf gegen alle anderen gewinnen – aus historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Gründen. Sie will eine Brückenbauerin sein über den Atlantik.
China argumentiert in Afrika mit seiner Vorgeschichte aus dem Jahr 1400, als Admiral Zheng He mit seiner Flotte vom Reich der Mitte aufbrach und sich mit dem Austausch von Handelsgütern Freunde an der afrikanischen Ostküste machte. Politiker in Neu-Delhi betonen gerne, dass die Inder nicht wie die Europäer als Eroberer und Kolonisatoren kamen, sondern als »Gastarbeiter« und Kaufleute, und dass Mahatma Gandhi, der große Freiheitsheld, durch seine jahrelangen Erfahrungen Ende des 19. Jahrhunderts in Südafrika wesentlich geprägt worden sei. Brasilien kann diese Vorgeschichten mühelos übertrumpfen. Einige Millionen Jahre hing man ja – im wahrsten Sinn des Wortes – zusammen, bis die Kontinentalverschiebung einsetzte. Und was das Mittelalter betrifft, hätte der Austausch zwischen Afrika und Südamerika kaum intensiver, allerdings auch kaum trauriger sein können. Brasilien wurde wesentlich durch den Sklavenhandel zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert geprägt, nicht einmal nach Nordamerika wurden so viele Sklaven verschleppt. Bis heute leben – mit der Ausnahme von Nigeria – in keinem Staat der Erde so viele Schwarze wie in Brasilien. Erst 1888 hat das Land die Sklaverei abgeschafft, die Nachfahren der Verschleppten
Weitere Kostenlose Bücher