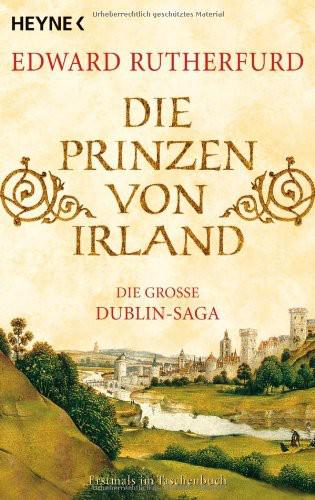![Die Prinzen Von Irland]()
Die Prinzen Von Irland
Eigentlich konnte ihr Vater Deirdre daher
nicht zwingen, einen bestimmten Mann zu heiraten, obwohl er ihr mit Sicherheit
das Leben schwer machen würde, wenn sie sich weigern sollte, überhaupt zu
heiraten.
In
der Vergangenheit hatten bereits einige Männer ihr ein Angebot gemacht. Aber da
Deirdre nach dem Tod ihrer Mutter den Haushalt führte und ihren Brüdern eine
Mutter war, hatte man die Ehefrage fürs Erste hintangestellt. Das letzte Mal,
als sie erwähnt wurde, war, soviel sie wusste, an einem Tag gewesen, als sie
sich gerade auf einem Gang außer Haus befand. Bei ihrer Rückkehr hatten die
Brüder ihr mitgeteilt, dass ein Mann nach ihr gefragt hatte. Aber der genaue
Wortlaut ihres Berichts war wenig ermutigend gewesen.
Ronan
und Rian: der eine zwei, der andere vier Jahre jünger als sie. Vermutlich waren
sie nicht schlimmer als andere Jungen in ihrem Alter, aber manchmal konnten sie
ihre Schwester wahrhaftig zur Weißglut bringen.
»Er
kam, als du fort warst«, hatte Ronan gesagt.
»Was
für ein Mann war das?«
»Och,
einfach ein Mann. Wie Vater. Aber jünger. Er war gerade auf Reisen
irgendwohin.«
»Und
weiter?«
»Sie
haben miteinander geredet.«
»Und?
Was hat Vater gesagt?«
»Er
hat – na, du weißt schon – einfach geredet.« Ronan glotzte Rian an.
»Wir
haben nicht lang zugehört«, fügte Rian hinzu. »Aber ich glaube, er hat ein
Angebot für dich gemacht.«
Sie
musterte die beiden. Sie drückten sich nicht einmal um eine Antwort herum – sie
redeten einfach so, wie sie nun einmal waren. Zwei zappelige, schlaksige
Kinder, die schlicht und einfach unverbesserlich waren.
Was,
fragte sie sich, würde wohl ohne sie aus ihnen werden?
»Wärt
ihr traurig, wenn ich euch alle verlassen würde und heirate?«, hatte sie
spontan gefragt.
Wieder
hatten sich die beiden angeglotzt.
»Eines
Tages wirst du’s ja mal tun«, meinte Ronan.
»Das
würde uns nichts ausmachen«, sagte Rian. »Du könntest uns ja besuchen kommen«,
fügte er dann ermutigend als späten Geistesblitz hinzu.
»Ihr
seid wirklich sehr freundlich«, entgegnete sie mit einer bitteren Ironie, die
ihnen vollständig entging. Es war sinnlos, dachte sie, von Jungen in diesem
Alter Dankbarkeit zu erwarten.
Als
sie später ihren Vater nach diesem Mann gefragt hatte, hatte er kurz angebunden
reagiert. »Er hat nicht genug geboten.«
Die
Verehelichung einer Tochter wollte in der Tat wohl bedacht sein. Einerseits war
eine ansehnliche junge Frau von vornehmem Geblüt für jede Familie ein
wertvolles Kapital. Aber der Mann, der sie heiratete, würde den Brautpreis
zahlen müssen, von dem ihr Vater seinen Anteil erhalten würde. So war der
Brauch auf der Insel.
Und
nun war Fergus angesichts der Art, wie seine Geschäfte standen, ganz offenbar
zu dem Schluss gelangt, dass er seine Tochter verkaufen musste. Eigentlich
durfte sie das nicht überraschen. So war es nun einmal. Und doch konnte sie
nicht verhindern, dass sie sich ein wenig verletzt und verraten fühlte. Ist das
wirklich alles, was ich ihm bedeute, so fragte sie sich – nach allem, was ich
für ihn getan habe, seit seine Frau starb? Genau wie ein Stück Vieh, das man
sich so lange wie nötig hält und dann verkauft? Sie hatte geglaubt, er hätte
sie geliebt. Und das tat er, so überlegte sie sich, wahrscheinlich tatsächlich.
Anstatt sich selbst zu bedauern, sollte sie vermutlich ihn bedauern und
versuchen, ihm zu helfen, indem sie einen würdigen Mann für sich fand.
Sie
sah gut aus. Sie hatte die Leute sogar sagen hören, sie sei schön. Nicht dass sie etwas
ganz Besonderes gewesen wäre. Sie war sicher, dass es Dutzende von anderen
Mädchen auf der Insel gab, die sanftes goldenes Haar, füllige Lippen und gute
weiße Zähne wie sie hatten. Ihre Wangen waren, so ging die Rede, von der zarten
Farbe des Fingerhuts. Außerdem hatte sie, wie sie seit jeher fand, auch hübsche
kleine Brüste. Aber das aufregendste Merkmal, das sie besaß, waren ihre Augen,
die von sonderbarstem und wunderschönstem Grün waren. »Ich weiß nicht, woher du
die hast«, hatte ihr Vater einmal zu ihr gesagt, »obwohl die Leute sagen,
irgendwo in der Familie meiner Mutter hätte es eine Frau mit magischen Augen
gegeben.« Aber niemand in der Familie oder im Umkreis von Dubh Linn hatte Augen
wie diese. Sogar als sie noch ein Kind war, waren die Männer bereits von ihnen
fasziniert gewesen. Daher war sie stets zuversichtlich gewesen, dass sie, wenn
die Zeit dafür gekommen war, durchaus einen guten
Weitere Kostenlose Bücher