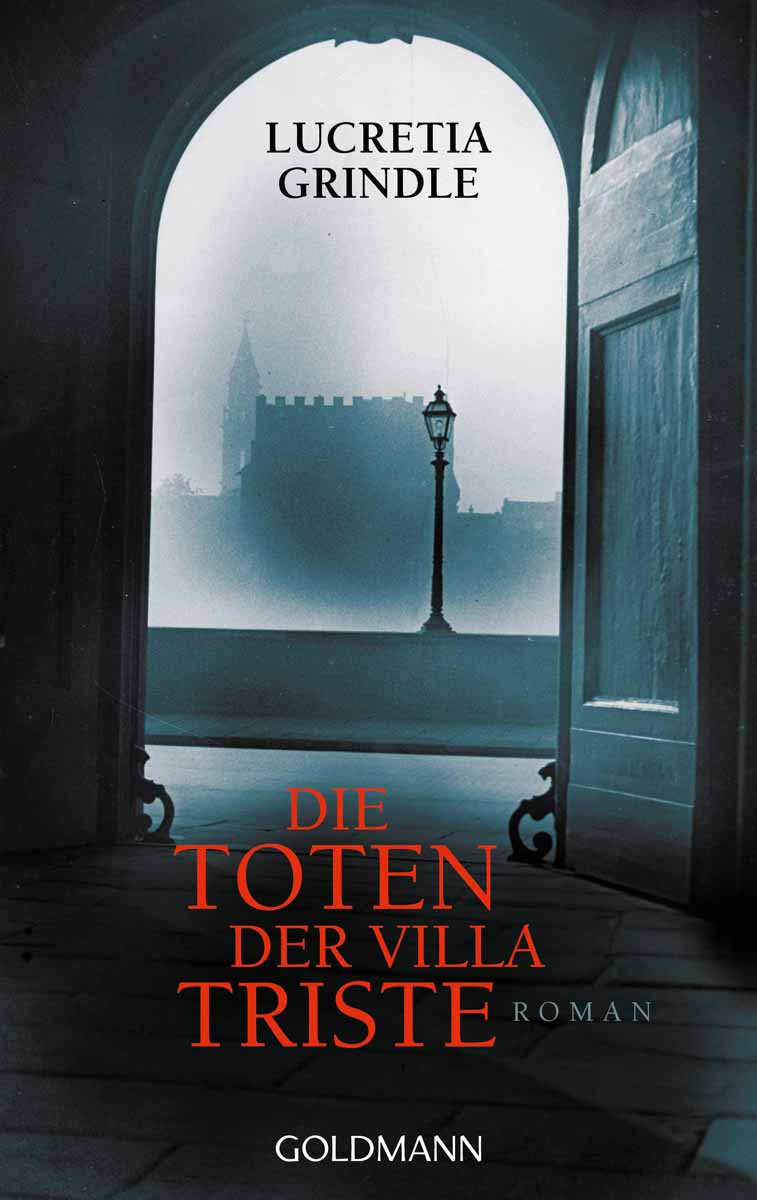![Die Toten der Villa Triste]()
Die Toten der Villa Triste
mir.«
Ich merkte, wie ich aus dem Tritt kam.
»Glauben Mama und Papa das auch? Dass ihr mir alle nicht vertrauen könnt?«
Ich blieb stehen und sah sie an. Sie schüttelte den Kopf.
»Nein. Nein.« Sie schüttelte noch einmal den Kopf. »Ich habe das nur gesagt, weil ich wütend auf dich war, seit du dich an dem Tag auf der Terrasse über uns lustig gemacht hast. Ich wollte dir einfach wehtun.« Ein paar ihrer Haarsträhnen hatten sich gelöst und lockten sich jetzt in der feuchten Luft. »Papa meinte, wir sollten dich nicht beunruhigen. Du müsstest dir schon genug Sorgen wegen deiner Arbeit im Krankenhaus und um Lodo machen. Er hat recht. Ich hätte das nicht sagen sollen. Das war falsch. Es tut mir leid.«
»Er wusste von Anfang an Bescheid, oder?«
Isabella wartete kurz ab, dann nickte sie. »Ja – er und ein paar andere Professoren. Anfangs haben sie uns geholfen. Bei der Organisation.« Sie beobachtete mich genau, während sie das sagte, weil sie wusste, wie sehr mich diese Neuigkeit, dieser zusätzliche Ausschluss, schmerzen würde. Sie legte die Hand auf meinen Arm. »Er wollte nicht mehr als unbedingt nötig riskieren. Er meinte, du wärst sicherer, wenn du nichts wüsstest.«
»Und was ist mit Mama?«
Mir war klar, dass ich das nicht hätte fragen sollen, aber ich konnte nicht anders. Es war, als müsste ich an einem Schorf pulen und immer weiter daran zupfen, obwohl die Wunde darunter längst wieder blutete. Issa blieb stumm.
»Und Enrico?« Ich musste daran denken, wie wir gemeinsam unter der Zeder gestanden hatten. »Vertraut er mir auch nicht?«
Isabella schüttelte den Kopf. Dann nickte sie. Ich sah in dem seltsam matt-feuchten Licht, wie ihr Blick weicher, verhangener wurde.
»Rico hat gesagt, ich soll mich an dich wenden, falls ich irgendwann etwas brauchen sollte. Ich habe ihm gesagt, dass du nicht mit dem einverstanden bist, was wir tun. Er sagte, das wäre egal.«
»Du hast ihn gesehen?«
Sie nickte.
Ich hob die Hand und legte die Fingerspitze meines Handschuhs unter ihr Auge. Das hellbraune Leder verdunkelte sich, bis es die gleiche Farbe hatte wie der Schmierer, den meine eigenen Tränen hinterlassen hatten.
»Ich bin nicht so tapfer wie du oder Rico«, flüsterte ich. »Das weißt du.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Es stimmt aber«, sagte ich. »Wir sind verschieden, Issa. Ich bin nicht wie du. Ich fürchte mich für uns alle. Ständig. Ich will nicht kämpfen. Ich will nur, dass endlich alles vorbei ist.«
Ein Pärchen schlenderte an uns vorbei. Wir gingen weiter, kamen an die Ecke und schlugen den Weg zur Brücke ein. Der Duft von gerösteten Maronen hing in der Luft. Ich blieb am nächsten Stand stehen und kaufte eine Tüte. Eine Weile gingen Issa und ich so dahin, schwiegen und kauten.
»Es ist zu gefährlich für Mama und Papa.« Ich senkte die Stimme, bis mein Murmeln vom Knistern der Papiertüte übertönt wurde. »Es ist mir gleich, ob Papa geholfen hat, alles zu organisieren. Wir müssen auf die beiden aufpassen. Wir müssen alles für sie tun. Nur deshalb bin ich so wütend auf dich«, stellte ich klar. »Wenn ihr verraten werdet, könnten Mama und Papa dafür erschossen werden. Du musst diese Männer aus unserem Haus schaffen.«
Issa nickte. »Ich weiß.«
Ich sah sie an.
»Ich helfe dir nur, wenn du mir versprichst – nein, wenn du mir schwörst –, dass du nie wieder jemanden in unserem Haus versteckst. Nie wieder.«
Sie nickte.
»Schon gut. Ja.«
»Für Mama und Papa.«
»Ja.«
»Was sie auch sagen. Schwörst du es?«
Sie sah mich an.
»Es ist mir ernst«, sagte ich. »Ich will, dass du das schwörst. Bei Mamas Leben.«
»Ich schwöre es bei Mamas Leben.«
»Na gut«, sagte ich gleich darauf. »Dann erzähl mir, was ich tun soll.«
Wir waren an der Brücke angelangt. Obwohl es so kalt und feucht war, eilten immer noch Passanten nach Hause oder wechselten vom Oltrarno in die Innenstadt. Ein paar wenige fütterten die Fische, warfen Brotkrumen und Maronenschalen ins Wasser. Issa nahm mich am Ellbogen und führte mich an die Balustrade. Wir schauten nach unten und konnten schemenhaft die dunklen Silhouetten, die kleinen Wellen im Wasser, gelegentlich ein schnappendes Maul erkennen.
»Wir haben einen Krankenwagen organisiert«, murmelte sie. »Und einen Fahrer. Um sie nach Fiesole zu bringen. Ins Kloster.«
Das Kloster diente inzwischen als Hospital und als Erholungsheim für Soldaten, die unter Schock standen oder Schlimmeres erlitten hatten. Die
Weitere Kostenlose Bücher