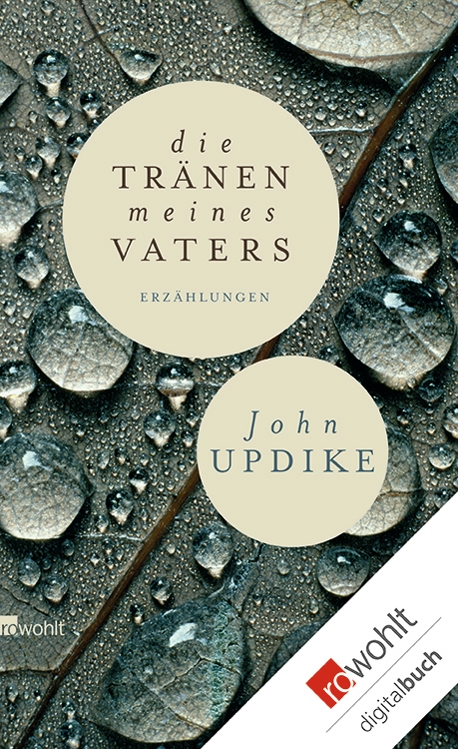![Die Tränen meines Vaters]()
Die Tränen meines Vaters
wie zu einem Kind, das sie nicht gut kannte, aber mit dem einen langen Nachmittag zu verbringen ihr bestimmt war. «Ich könnte mir denken, sie haben uns bloß etwas vorgemacht», sagte sie einmal. «Angenommen, du schaffst es nicht, eine Reise in den Himmel hinauf zu machen?» Und ein andermal: «Ich habe gewusst, dass ich langweilig fürdich war, aber ich wusste nicht, wie ich anders sein sollte.» In ihrer Ratlosigkeit angesichts seiner Tränen strich sie ihm übers Haar, wagte es nicht, sein Gesicht zu berühren.
«Ich fahre jetzt lieber zurück», sagte er.
«Zurück wohin?», fragte Leila.
In das Hotel, das Irene geliebt hatte, mit den ausgestopften Fischen und den namenlosen Muscheln und dem kargen Komfort. Zu dem Frieden, den er bei der Vorstellung fand, dass sie noch bei ihm war. Seit ihrem Tod war er umhüllt von ihr wie von einem zarten Gespinst aus Gold- und Silberfäden.
«Du warst immer auf dem Weg zurück», sagte Leila. Ihr Ton war nicht bitter, nur nachdenklich, den akkuraten Kopf hielt sie selbstbewusst zur Seite geneigt, wie um zu betonen, was sie war: eine kleine alte Dame, noch immer bereit, ihre Chancen zu nutzen, ihr Blatt zu spielen. «Aber jetzt bist du frei.»
Wieder in ihrem Wohnzimmer, sah Henry sich schon draußen vor der Tür, unter einem umgrenzten Himmel, der diesmal rechteckig war. Es würde eine lange Fahrt werden, gegen das Licht der untergehenden Sonne, durch den großen Südflorida-Sumpf. «Nun ja, was bedeutet ‹frei›?», fragte er. «Ich denke, es ist immer ein Geisteszustand. Wenn ich auf uns zurückblicke – vielleicht war das so frei, wie etwas nur sein kann.»
Der Spaziergang mit Elizanne
Ihr Jahrgang hatte den Highschool-Abschluss 1950 gemacht, an der Olinger High, wenige Jahre bevor der Name der Schule einer Neuaufteilung der Verwaltungsbezirke zum Opfer gefallen war. Obwohl das Jahr 2000 in Jahrbuch-Vorhersagen und -Witzen zwangsläufig eine Rolle spielte, hatte niemand wirklich geglaubt, dass ein so futuristisches Datum jemals Gegenwart werden würde. Sie waren siebzehn und achtzehn; ihr fünfzigstes Jahrgangstreffen war unausdenklich fern. Jetzt war es da, im Veranstaltungsraum des Fiorvante’s, eines Restaurants in West-Alton, eine halbe Meile vom imposanten City-Hospital entfernt, in dem viele von ihnen geboren waren und jetzt eine von ihnen schwerkrank darniederlag.
David Kern und seine zweite Frau Andrea, die lange genug seine Frau war, um keine Fremde bei seinen Highschool-Treffen zu sein, gingen hinüber ins Hospital und besuchten Mamie Kauffman in ihrem Krankenzimmer, in dem sie seit sechs Wochen schon lag: ihre Knochen waren so von Krebs zerfressen, dass sie nicht mehr gehen konnte. Sie hatte allein in einem Haus gelebt, das sie und ein seit langem verschwundener Ehemann vor vierzig Jahren gekauft hattenund in dem sie drei Kinder mit ihrem Grundschullehrerinnengehalt großgezogen hatte. Karten mit Genesungswünschen und Zeichnungen von Generationen ihrer Schüler füllten die Fensterbänke und Wände des Zimmers. Mamie war wie immer, übersprudelnd und herzlich, obwohl sie sich nicht einmal zu sitzender Haltung hochziehen konnte.
«Was für einen Strom von Liebe mir das hier eingebracht hat», sagte sie zu dem Paar. «Ich hatte Mitleid mit mir selbst und habe mich, das muss man wahrscheinlich so sagen, nicht genug geliebt gefühlt, bis diese Sache passiert ist.» Sie schilderte, wie es gewesen war: sie stand aus dem Bett auf und fühlte, wie ihr Hüftgelenk brach, fühlte sich in die Ecke geschleudert wie eine Stoffpuppe und zog das Telephon, das glücklicherweise auf dem Fußboden stand, mit ihrem Stock zu sich heran. Sie hatte seit einiger Zeit einen Stock benutzt, wegen ihrer, wie sie gemeint hatte, rheumatoiden Arthritis. Zuerst hatte sie vor, ihre zwei Ortschaften entfernt wohnende Tochter Dorothy anzurufen. «Ich war so wütend über mich, dass ich einfach nicht draufkam, was für eine Nummer Dot hat, dabei wähle ich sie jeden zweiten Tag, und dann sagte ich mir: ‹Mamie, es ist halb drei in der Frühe, du willst nicht Dots Nummer, du willst neun-eins-eins. Du willst einen Rettungswagen.› Zehn Minuten später waren sie da und so nett, das kann man sich gar nicht vorstellen. Einer der Sanitäter, stellte sich heraus, war vor zwanzig Jahren einer meiner Zweitklässler gewesen.»
Andrea lächelte und sagte: «Das ist schön.» In diesem überdekorierten Krankenzimmer sah sie jung aus, lebensvoll, effizient, anmutig; David war stolz auf sie.
Weitere Kostenlose Bücher