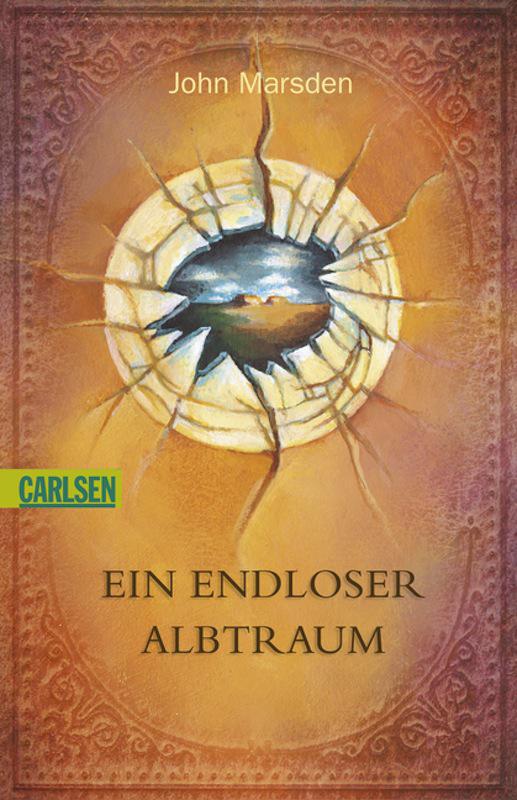![Ein endloser Albtraum (German Edition)]()
Ein endloser Albtraum (German Edition)
Redensart ist?«, sagte Lee. Sein Kopf war zur Seite geneigt, während er mich ansah. Ich hatte das unheimliche Gefühl, dass er genau wusste, was ich dachte.
Aber ich sagte nur: »Was?«
Lee zuckte mit den Achseln. »Beim Film ist das der häufigste Satz. Kommt in sechzig Prozent aller Filme vor.«
Er kam herüber und half mir auf die Beine, während die anderen sich langsam in Bewegung setzten. Wir humpelten zum Bach, um uns auf den Weg zu machen. Mir graute vor dem langen, qualvollen Marsch flussaufwärts, vor dem gekrümmten Rücken und der eiskalten Strömung, die an unseren Beinen ziehen würde. Das einzig Gute – und Schlechte – war, dass wir uns nicht mehr mit unseren Rucksäcken abschleppen mussten. Während wir gingen, brachte ich eine ganze Weile damit zu, die Dinge aufzuzählen, die ich verloren hatte. Es war deprimierend. Uns war schon so vieles genommen worden; ständig mehr zu verlieren schien so ungerecht. Vielleicht würden wir am Ende gar nichts mehr haben. Keine Freude, keine Zukunft, nicht einmal mehr das nackte Leben. Vielleicht hatten wir zwei von diesen drei Dingen ohnehin schon verloren. Ich weinte wieder; und die ganze Zeit wateten wir durch den Bach in die Hölle hinauf.
Als wir das Lager erreichten, war es noch früher Vormittag. Es fühlte sich mindestens wie Mittag an. Vor der Invasion hatten unsere Tage um neun Uhr gerade erst begonnen. Wir saßen mit zerzaustem Haar in der Klasse, rieben uns verschlafen die Augen und gähnten. Jetzt hatten wir vor dem Frühstück mehr durchgemacht – mehr durchlitten –, als wir berechtigterweise in einem ganzen Leben erwarten konnten.
Das war noch so etwas, das ich erst lernen musste: dass Erwartungen nichts mehr bedeuteten. Wir hatten kein Recht, irgendetwas zu erwarten. Sogar die Dinge, die selbstverständlich waren, hatten aufgehört selbstverständlich zu sein, denn auch sie waren nichts anderes als eine Erwartung. Zum einen wäre mir nicht im Traum eingefallen, dass Chris nicht mehr da sein könnte. Selbstverständlich würde er da sein. Aber er war es nicht.
Zuerst beunruhigte uns das nicht weiter. Wir waren zu sehr damit beschäftigt, unseren Hunger zu stillen, und riefen nur immer wieder seinen Namen. Zumindest die anderen taten das. Mir war schlecht und meine Hände taten höllisch weh. Zuerst dachte ich auch, ich wäre hungrig, aber dann brachte ich keinen Bissen hinunter. Ich saß auf einem Baumstamm und sah zu, wie Robyn Bohnen aus der Dose und Käse verschlang, Lee sich über die Kekse und die Marmelade hermachte, Fi einen Apfel und Trockenfrüchte aß und Homer Müsli in sich hineinstopfte. Mit noch vollem Mund ging Robyn los, holte den Erste-Hilfe-Kasten und brachte ihn zu mir.
»Wie geht es deinen Händen?«, fragte sie.
»Geht so. Mein Knie tut mehr weh.«
Da ich auf dem Weg durch den Bach meine Hände immer wieder ins Wasser getaucht hatte, waren die Steinchen und der Schmutz aus den Wunden herausgewaschen. Die Haut rund um meine Fingerspitzen sah jetzt weich und zart aus, aber die Kuppen waren dunkle erdbeerrote Wunden, von denen kleine Hautfetzen abstanden. Meine Fingerkuppen sahen aus, als hätte ich sie mit Schmirgelpapier entfernt. Auch die beiden Handflächen waren aufgeschürft und brannten, aber das Schlimmste hatten die Fingerspitzen abbekommen. Robyn schmierte die Wunden mit einer Salbe ein und verband zunächst jeden Finger einzeln mit Mullstoff und dann mit Verband. Währenddessen fütterte sie mich wie ein Vogelweibchen ihr Küken. Als sie fertig war und meine acht Finger hübsch und weiß verpackt in die Luft ragten, fühlte ich mich besser; außerdem hatte ich jetzt mehrere Datteln und Kekse im Bauch.
»Was meinst du, wo Chris sein könnte?«, fragte ich sie, als sie den letzten Finger verbunden hatte.
»Keine Ahnung. Wir waren ziemlich lange weg. Hoffentlich ist ihm nichts passiert.«
»Ich stelle es mir ziemlich einsam vor, hier ganz allein.«
»Ja, aber ich glaube nicht, dass das für Chris ein Problem ist.«
»Hmmm. Er ist ein komischer Typ.«
Nach dem Essen machten wir uns ernsthaft auf die Suche. Weit musste man in der Hölle nicht suchen. Wir wussten, dass er nicht in der Hütte des Einsiedlers war, denn dort waren wir auf dem Weg zur Lichtung vorbeigekommen. Homer und Fi nahmen sich den Weg bis zurück zum Wombegonoo vor, während wir anderen den Busch durchkämmten, für den Fall, dass er einen Unfall gehabt hatte. Ich lief mit in die Luft gestreckten Händen herum und fühlte mich nutzlos.
Weitere Kostenlose Bücher