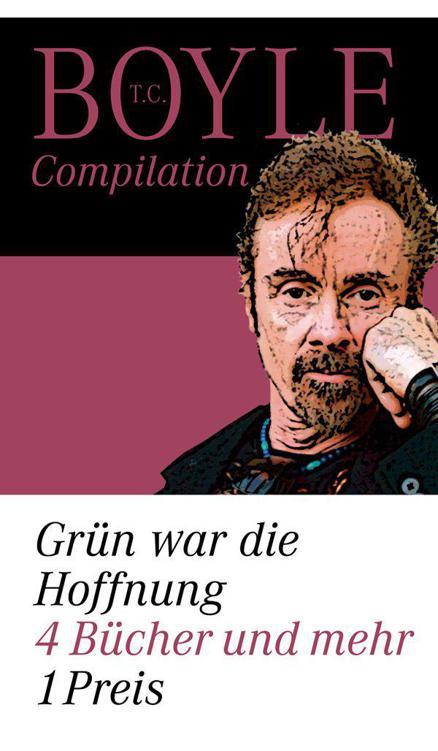![Grün war die Hoffnung]()
Grün war die Hoffnung
saß, mit einem Freund, ein gutaussehender Mann in den Dreißigern. Er trug ein Tournee-T-Shirt, auf dessen Rücken ein Bild von Micah Stroud mitsamt Gitarre war, und das war in ihren Augen ein Pluspunkt, denn damals war Micah Stroud nur Eingeweihten ein Begriff. Und ihr gefielen sein Lächeln, seine Haltung, seine Frisur, die eine Einstellung zum Ausdruck brachte: Es gab nicht viele Männer seines Alters mit Dreads. Sie hielt ihn für einen Musiker oder Künstler, einen Schriftsteller oder Fotografen vielleicht, für einen freien, unabhängigen Geist jedenfalls. »Sie sehen so allein aus«, sagte er. »Wollen Sie sich nicht zu uns setzen?«
Und das tat sie. Es war ein schöner Abend. Und als das Wochenende kam, rief er an und lud sie zum Essen ein, in ein Restaurant ihrer Wahl. Nach Rayfield und drei Jahren auf Guam, wo sie gelernt hatte, allein zurechtzukommen, war sie nicht sonderlich erpicht auf eine neue Beziehung, und da sie über ihn nicht mehr wusste als das, was er ihr selbst erzählt hatte – ihm gehörten ein paar Elektronikläden, er war geschäftlich erfolgreich, liebte die Natur und war Single –, entschied sie sich für ein Lokal im Lower Village. Teuer, aber welches Restaurant war das nicht? Die Küche war italienisch und gehoben, und sie war so oft dort gewesen, entweder allein oder in Gesellschaft einer Kollegin, dass man sie als Stammgast betrachtete. Oft genug jedenfalls, um von Giancarlo, dem Besitzer und Oberkellner, besonders zuvorkommend und fürsorglich behandelt zu werden, wenn sie mit einem Fremden dort zu Abend aß. Der sich möglicherweise als die große Liebe ihres Lebens erweisen würde. Oder als Katastrophe.
Es begann verheißungsvoll. Er erschien zu Fuß, brachte Lilien vom Blumenmädchen – oder vielmehr der Blumenfrau – um die Ecke mit und plauderte mit ihr über dies und das, während sie die Blumen in eine Vase stellte, ihren schwarzen Spitzenschal um die Schultern legte und ihn zur Tür führte. Sie gingen die Straße hinunter, überquerten auf der Brücke die Schnellstraße und schlenderten zum Lower Village. Die Unterhaltung lief leicht und locker dahin: Er hatte ein Haus dort oben auf dem Hügel, kaum einen Kilometer entfernt, und kam andauernd an ihrem Haus vorbei, und wie lange wohnte sie dort eigentlich schon? Drei Monate? Wieso hatte er sie dann noch nie gesehen? Er konnte es nicht glauben. Wahrscheinlich hatte sie keinen Hund, denn wenn sie einen hätte, wären sie sich bestimmt auf dem Hügel oder auf der Straße oder am Strand begegnet. Nein, sie hatte keinen Hund – das hatte er ja sicher bemerkt –, obwohl sie Hunde liebte, aber sie war noch dabei, sich einzuleben, und musste beruflich oft hinaus auf die Inseln, wo Hunde verboten waren, weil sie Krankheiten unter den Füchsen und Skunks verbreiten konnten. Die Inseln? sagte er. Ich liebe die Inseln.
Giancarlo begrüßte sie an der Tür und führte sie zu einem Tisch am Fenster, und dann kam der Ober – Fredo, ein hochgewachsener, düster blickender Chilene, der sich aus Gründen der Authentizität einen neapolitanischen Habitus und Akzent zugelegt hatte – mit der Weinkarte. »Was möchten Sie trinken?« fragte LaJoy sie. »Rotwein oder Weißwein?«
Sie zuckte die Schultern. »Ich mag Rotwein lieber«, sagte sie.
»Ja«, sagte er, »ich auch. Es kommt natürlich auf das Essen an. Und den Anlass.«
»Ich bin eigentlich nicht so schwer zufriedenzustellen«, gestand sie. »Das kommt davon, wenn man drei Jahre auf Guam verbracht hat.« Sie lachte sarkastisch. »Auf Guam trinkt man, was man kriegen kann. Hauptsächlich Sake. Und Whiskey. Oder wie er dort heißt: Whieski. Whieski Soda. Und Gin natürlich. Gin Tonic, das alte Allheilmittel.«
Darauf hatte er nicht viel zu sagen. Er vertiefte sich in die Weinkarte, und seine Dreads fielen ihm in die Stirn, so dass sie das rosige Mosaik seiner Kopfhaut sehen konnte. Er fuhr mit dem Finger bis zum Fuß der Liste und sah auf zu Fredo. »Schicken Sie mir den Sommelier.«
Fredo stand da, die Hände auf den Rücken gelegt, korrekt wie ein Bestattungsunternehmer. »Leider«, sagte er und kämpfte mit seinem Akzent, »haben wir eigentlich keinen Sommelier.«
» Eigentlich? « LaJoy – Dave – sah ihn ungläubig und unwillig an. »Was soll das denn heißen? Haben Sie einen Sommelier oder nicht? Oder werden die Weine auf dieser Karte von der Zahnfee ausgeschenkt?«
»Nein, Sir, dafür sind ich«, begann Fredo, »oder Giancarlo –«
»Dann holen Sie ihn
Weitere Kostenlose Bücher