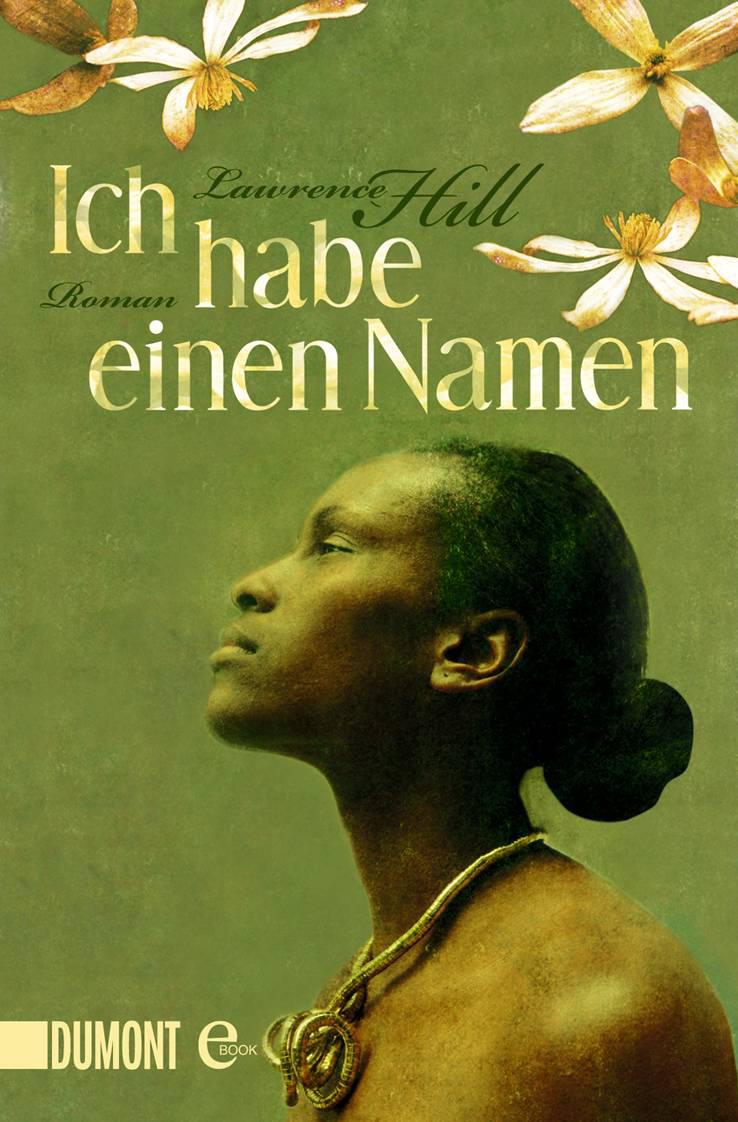![Ich habe einen Namen: Roman]()
Ich habe einen Namen: Roman
mich, dass sie mich vor Ungemach bewahrt
und vorsichtig um die Kochfeuer und in den kühlen Schatten unseres Hauses
geführt haben. Ich sehe meinen Vater noch vor mir, wie er mit einem spitzen
Stock fließende arabische Sätze in den harten Boden kratzt und vom fernen
Timbuktu erzählt.
Wenn ich ganz für mich
bin und die Abolitionisten einmal nicht um mich herumwirbeln, wenn ich nicht an
dieser Delegation teilnehmen oder meine Unterschrift unter jene Petition setzen
soll, wünsche ich mir, dass meine Eltern noch da wären und sich um mich
kümmerten. Ist das nicht merkwürdig? Dass ich, eine schwache, alte schwarze
Frau, die in ihrem Leben mehr Wasser überquert hat, als dass sie sich noch an
all die Tage auf See erinnern könnte, die mehr Wegstunden hinter sich gebracht
hat als ein Karrengaul, dass ich nur von Dingen träume, die ich nicht haben
kann: von Kindern und Enkeln, die ich lieben möchte, und Eltern, die sich um
mich kümmern.
Vor ein paar Tagen
haben sie mich in eine Londoner Schule gebracht, wo ich mich mit den Kindern
unterhalten habe. Ein Mädchen fragte, ob es stimme, dass ich die berühmte Meena
Dee sei, von der alle Zeitungen schrieben. Ihre Eltern, sagte sie, glaubten
nicht, dass ich an so vielen Orten gelebt hätte. Ich bestätigte ihr, dass ich
Meena Dee sei, aber sie könne mich ruhig Aminata Diallo nennen, denn so habe
ich als Kind geheißen. Mit dem Vornamen hatten wir eine Weile zu tun. Beim
dritten Mal hatte sie es. Aminata . Vier Silben. So schwer ist es wirklich
nicht. A-mi-na-ta , sagte ich. Sie sagte, sie würde sich wünschen, dass ich ihre Eltern
kennenlernte. Und ihre Großeltern. Ich erwiderte ihr, wie wunderbar es sei,
dass sie ihre Großeltern noch habe. Liebe sie, sagte ich, liebe sie von ganzem
Herzen. Liebe sie jeden Tag. Sie wollte wissen, warum ich so schwarz sei. Ich
fragte sie, warum sie so weiß sei. Sie sagte, sie sei so auf die Welt gekommen.
Da geht’s mir genauso, antwortete ich. Ich kann sehen, dass du mal ziemlich
schön gewesen sein musst, obwohl du so schwarz bist, sagte sie. Du wärst noch
hübscher, wenn in London mal die Sonne schiene, antwortete ich. Sie fragte
mich, was ich äße. Mein Großvater sagt, er wettet, du isst rohen Elefanten. Ich
sagte ihr, dass ich noch nie was von einem Elefanten abgebissen hätte, in
meinem Leben aber schon hungrig genug gewesen sei, dass ich es probiert hätte.
Drei- bis vierhundert hätte ich schon von ihnen gejagt, sagte ich, es aber nie
geschafft, sie daran zu hindern, durch die Dörfer zu trampeln, oder einen von
ihnen so lange festzuhalten, dass ich in Ruhe hätte reinbeißen können. Sie
lachte und sagte, sie wolle wissen, was ich wirklich äße. Das Gleiche wie du,
erklärte ich ihr. Glaubst du, ich finde hier in den Straßen von London einen
Elefanten? Würste, Eier, Hammeleintopf, Brot, Krokodile, all die ganz normalen
Sachen würde ich essen. Krokodile?, fragte sie. Ich sagte, ich hätte nur sehen
wollen, ob sie mir richtig zuhört. Sie sagte, sie sei eine sehr gute Zuhörerin,
und ob ich ihr nicht bitte eine Gespenstergeschichte erzählen
könne.
Schätzchen, sagte ich,
mein ganzes Leben ist eine Gespenstergeschichte. Dann erzähl sie mir, sagte
sie.
Wie ich ihr gesagt
habe, heiße ich Aminata Diallo. Ich bin die Tochter von Mamadu Diallo und Sira
Kulibali. Geboren bin ich in Bayo, drei Monde Fußmarsch von der Getreideküste
Westafrikas entfernt. Ich bin eine Bambara. Und eine Fulbe. Ich bin beides,
aber das erkläre ich später. Ich denke, dass ich 1745 geboren wurde, vielleicht
auch kurz vorher oder nachher. Und ich schreibe diesen Bericht. Von Anfang bis
Ende. Für den Fall, dass ich sterbe, bevor ich fertig werde, habe ich John
Clarkson, einem der ruhigeren Abolitionisten und dem einzigen, dem ich wirklich
traue, das Versprechen abgenommen, nichts daran zu verändern. Seine
Abolitionisten-Freunde hier in London wollten von mir einen kurzen, vielleicht
zehnseitigen Aufsatz darüber, warum der Handel mit Menschen eine
Abscheulichkeit ist und gestoppt werden muss. Den habe ich ihnen geliefert, und
er ist in ihrem Büro verfügbar.
Ich habe eine
tiefdunkle Haut. Einige Leute sagen, sie ist blauschwarz. Meine Augen geben
kaum etwas von mir zu erkennen, und das gefällt mir so. Misstrauen, Verachtung,
Widerwillen, ich mag solche Gefühle nicht öffentlich zur Schau stellen. Manche
sagen, dass ich einmal ungewöhnlich schön war, aber ich wünsche keiner Frau
Schönheit, die nicht frei ist und selbst bestimmen
Weitere Kostenlose Bücher