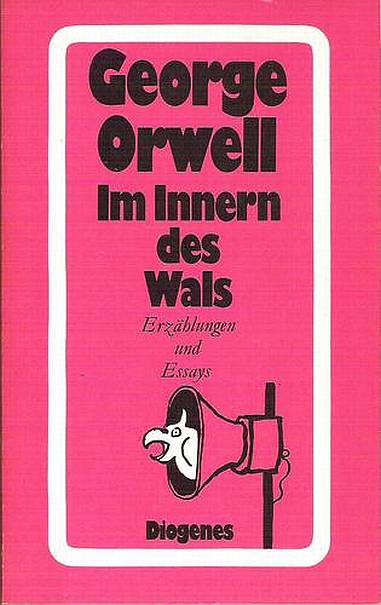![Im Innern des Wals]()
Im Innern des Wals
furchtbare Einschlag der Kugel ihn gelähmt, ohne ihn niederzuwerfen. Nach einer Zeit, die mir unendlich lang vorkam – in Wirklichkeit mögen es nur ein paar Sekunden gewesen sein –, sackte er schlapp in die Knie. Aus dem Maul troff schleimiger Speichel. Eine grenzenlose Schwäche schien ihn befallen zu haben. Man hätte glauben können, er sei tausend Jahre alt. Ich feuerte einen weiteren Schuß auf die gleiche Stelle ab. Auch nach dem zweiten Schuß brach er nicht zusammen, im Gegenteil, er erhob sich mit entsetzlicher Langsamkeit und kam wieder auf die Beine. Aber sie zitterten, und er ließ den Kopf sinken. Ich schoß ein drittes Mal. Diesmal war es das Ende. Man sah, wie der Todeskampf den ganzen Körper schüttelte, der letzte, klägliche Rest von Kraft schwand aus seinen Beinen. Noch im Fallen schien er sich für einen Moment zu erheben: während die Hinterbeine unter ihm nachgaben, bäumte er sich auf wie ein riesiger stürzender Felsblock, der aufschnellt. Sein Rüssel reckte sich wie ein Baum zum Himmel. Zum ersten- und einzigenmal stieß er ein lautes Trompeten aus. Dann fiel er um, mir den Bauch zukehrend, mit einem Aufprall, der den Boden bis zu der Stelle, an der ich lag, beben ließ.
Ich stand auf. Die Burmesen rannten bereits an mir vorbei über das Schlammfeld. Es war offensichtlich, daß sich der Elefant nicht wieder erheben würde, aber er war noch nicht tot. Er atmete stöhnend, in langen, regelmäßigen Abständen, die eine Flanke seines Riesenleibes hob und senkte sich mühsam und qualvoll. Das Maul stand weit offen, so daß ich tief in die Höhlung seines blaßrosa Schlundes sehen konnte. Ich wartete lange, in der Hoffnung, er würde sterben, aber das regelmäßige Atmen hielt an. Schließlich feuerte ich meine beiden letzten Patronen auf eine Stelle ab, wo ich das Herz vermutete. Ein dicker Blutstrahl, rot wie purpurner Samt, schoß aus der Wunde, aber er war noch immer nicht tot. Sein Leib zuckte nicht einmal unter den Schüssen zusammen, ohne Unterbrechung dauerte das qualvolle Atmen an. Er lag im Sterben, aber es ging sehr langsam, der Todeskampf schien sich in einer andern Welt, weitab von der unseren, abzuspielen, in der ihm nicht einmal meine Schüsse etwas anhaben konnten. Ich fühlte, daß ich diesem entsetzlichen Stöhnen ein Ende machen mußte. Es war mir furchtbar, das gewaltige Tier hilflos daliegen zu sehen, unfähig, sich zu rühren, und unfähig zu sterben. Ich ließ mir mein kleines Gewehr geben und feuerte Schuß auf Schuß auf sein Herz und in seinen Rachen. Sie schienen ihn nicht zu beeindrucken. Das qualvolle Keuchen ging weiter, regelmäßig wie das Ticken einer Uhr.
Ich hielt es schließlich nicht länger aus und ging. Später hörte ich, daß es noch eine halbe Stunde gedauert hatte, bis der Elefant starb. Noch bevor ich verschwunden war, rückten die Burmesen mit Beilen und Buschmessern an. Bis zum Nachmittag hatten sie, wie man mir erzählte, das Tier bis auf die Knochen ausgeweidet.
Später gab es natürlich endlose Debatten über den Abschuß des Elefanten. Der Eigentümer war außer sich vor Wut, aber er war nur ein Inder und konnte nichts tun. Nach den gesetzlichen Bestimmungen hatte ich richtig gehandelt, denn ein wild gewordener Elefant muß wie ein tollwütiger Hund erschossen werden, wenn der Eigentümer ihn nicht unter Kontrolle hat. Unter den Europäern waren die Meinungen geteilt. Die Älteren vertraten die Ansicht, ich hätte richtig gehandelt, die Jüngeren sagten, es sei eine verdammte Schande, einen Arbeitselefanten zu erschießen, nur weil er einen von diesen verdammten Goringhee-Kulis getötet hatte, der nicht soviel wert war wie ein Elefant. Nachträglich war ich ganz froh, daß er den Kuli getötet hatte; das lieferte mir die gesetzliche Rechtfertigung und einen hinreichenden Vorwand dafür, den Elefanten umgebracht zu haben. Ich habe mich oft gewundert, daß keiner den eigentlichen Grund erriet, warum ich es getan hatte – nämlich aus Angst, mich lächerlich zu machen.
New Writing No. 2 , Herbst 1936
Hopfenpflücken
25. August 1931
In der Nacht vom 25. verließ ich Chelsea mit etwa 14s. in der Tasche und suchte das Nachtquartier von Lew Levy an der Westminster Bridge Road auf. Es ist fast noch genauso wie vor drei Jahren, nur kosten heute fast alle Betten 1s. statt 9p. (s. = Schilling, p. = Penny) – dank der Einmischung des L.C.C. (London Country Council), auf dessen Anordnung (aus hygienischen Gründen, wie gewöhnlich) die
Weitere Kostenlose Bücher