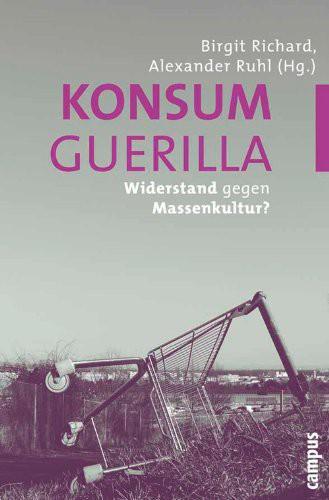![Konsumguerilla - Widerstand gegen Massenkultur]()
Konsumguerilla - Widerstand gegen Massenkultur
Kommunikationsfunktion des Konsums überzeugt, dass sie dazu auffordert, alle anderen Dimensionen auszublenden: »Forget
that commodities are good for eating, clothing, and shelter; forget their usefulness and try instead the ideas that commodities
are good for thinking« (1978: 62). Die Paradoxie ihrer theoretischen Orientierung wird in diesem Zitat deutlich: Die materialen,
stofflichen Aspekte des Konsums – Essen, Bekleidung, Unterkunft – sind völlig irrelevant geworden. In ihrer Analyse zählen
nur noch die durch die Objekte kommunizierten Botschaften. Diese Theorie stellt zweifellos einen signifikanten Fortschritt
gegenüber der Konsumkritik dar, aber |27| sie führt zugleich zu einer gefährlichen Verkürzung in der Wahrnehmung des Konsums als solchem, eine Verkürzung, der auf der
Basis einer ethnographischen Annäherung unbedingt zu widersprechen ist.
Neben dieser Perspektive auf Konsum im Umfeld des Arguments »Konsum als Kommunikation« gibt es eine zweite, große Tradition
der Interpretation von Konsum, die in den letzten Jahrzehnten ebenfalls große Resonanz gefunden hat. Es handelt sich dabei
um die Untersuchung von Bedürfnissen und um die Frage nach dem Zusammenhang von expandierendem Konsum und Bedürfniswandel.
Dem grundlegenden Bild der Bedürfnispyramide zufolge stehen verschiedene Bedürfnisse in einer Rangordnung. Wie beispielsweise
Abraham Maslow (1954) feststellt, wird die Basis aus so genannten Grundbedürfnissen wie Nahrung, Kleidung und Schutz vor Kälte
gebildet. Darüber stehen höhere Bedürfnisse, die erst danach befriedigt werden und kulturabhängig sind. Dazu könnte zum Beispiel
das Interesse an neuen Luxus-Konsumgütern gerechnet werden. Das Anliegen wichtiger Studien in diesem Rahmen ist jedoch eine
Kritik an diesem Bild. So betont Sydney Mintz (1985) in seiner Geschichte des Zuckers den Wandel von Bedürfnishierarchien.
Wie er zeigt, führte die Entwicklung eines globalen Marktes für Zucker zur Entstehung eines neuen Grundbedürfnisses (nämlich
nach Zucker). Doch auch wenn es den Konsumenten als ein Grundbedürfnis erscheint, ist dieses Konsumelement historisch bedingt.
In dem Buch mit dem Titel »The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism« (1987) problematisiert Colin Campbell
den Zusammenhang von Konsummustern und Bedürfnissen. Er untersucht den engen Zusammenhang zwischen dem Modell des modernen
Individuums und hedonistischen Auffassungen vom Ich. Letztlich kommt er zu dem Punkt, das Konzept der »Bedürfnisse« insgesamt
in Frage zu stellen. Nach Campbell ist die Konsumexpansion der Gegenwart zu einem konstitutiven Element des Individuums geworden,
das damit seiner romantischen Übersteigerung der »Sehnsucht« Ausdruck verleiht. Erst in dem Verlangen nach immer neuen Dingen,
die der moderne Mensch als »echte Bedürfnisse« empfindet, kann er seine Identität finden. Unterscheidungen zwischen Bedürfnissen
und Wünschen sind nicht mehr möglich. Folglich ist es in Konsumgesellschaften ganz unsinnig geworden, von Bedürfnissen zu
sprechen, da Wünsche und Motive deren Rolle übernommen haben. Wenn es noch eine Regel für Konsumenten gibt, dann die, im Sinne
von Campbells »romantischer Ethik« niemals aufzuhören zu wünschen, zu träumen und immer |28| neue Konsummöglichkeiten als die nächste und zugleich die nächstliegende Erlösung zu betrachten. Die Sehnsüchte der Konsumenten
haben jede Ordnung aufgelöst, und das »Prinzip des Gefallens« steht über jedem anderen kulturellen Muster. Wünsche und Sehnsüchte
nach immer neuen Konsumgütern brauchen nur noch eine Freiheit, nämlich die, die umgangssprachlich als die Entscheidungsfreiheit
des »Impuls-Käufers« bezeichnet wird. Campbells Theorie steht im Lichte dieser Gedanken in erstaunlicher Nähe zu Benjamins
Perspektive auf den Konsumenten als »Träumer«.
Doch zurück zu den beiden großen anthropologischen Traditionen der Theoriebildung: »Konsum als Kommunikation« sowie »Konsum
als Ausdruck sich wandelnder Bedürfnisstrukturen«. Beide weisen dem Konsum eine Funktion zu, oder, deutlicher noch: Der Konsum
erklärt in diesen Theorien, warum Gesellschaften soziale Strukturen haben, wie sich diese Strukturen ändern oder gar auflösen.
Im Gegensatz zu den Thesen der Konsumkritik ist in diesen Ansätzen Konsum nicht mehr eine Verfallsgeschichte der Kultur, sondern
ein Indikator von Kulturwandel. Allerdings: Der Konsum als solcher
Weitere Kostenlose Bücher