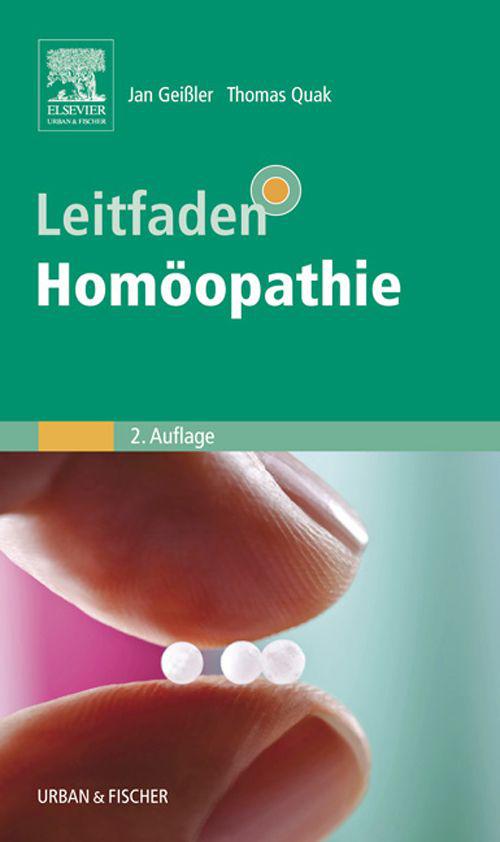![Leitfaden Homöopathie (German Edition)]()
Leitfaden Homöopathie (German Edition)
Verlaufsbeurteilung darstellen. Die meist zugrunde liegende psychosomatische Dimension erfordert entsprechend ausführliche Anamnesen und in der Folge Hierarchisierung und Repertorisation der Symptome bzw. ein umfassendes Verständnis des Patienten in Zusammenschau mit möglichen Arzneien (homöopathische Konstitutionstherapie). Tatsächlich gelingt es jedoch oft, schon mit wenigen, aber charakteristischen Symptomeneine gute Verschreibung zu tätigen und eine nachhaltige Besserung oder gar Heilung zu erzielen. Der Weg dahin führt immer über die Repertorisation der auffällig geschilderten Symptome.
Wahl der Symptome
Die Fälle mit funktionellen Herzbeschwerden sind sehr individuell und komplex, sodass hier nur die Zielrichtung angegeben kann, wo zu suchen ist. Im Einzelfall kann die Anamnese, vor allem die psychische, den Schwerpunkt der Symptomwahl bestimmen. Des Weiteren müssen, entsprechend den vorliegenden subjektiven Symptomen, auch die Inhalte der Kapitel Angina pectoris ( Kap. 29.1.1 ), Myokardinfarkt ( Kap. 29.1.2 ) und Herzrhythmusstörungen ( Kap. 29.3 ) berücksichtigt werden.
Symptomschilderung: V.a. Symptome, die aus kardiologischer Sicht uninteressant sind und den psychogenen Charakter anzeigen, sind homöopathisch wichtig, aber auch „Als-ob-Empfindungen“ des Herzens, wie z.B. „das Herz könne aufhören zu schlagen“ oder das Gefühl von Schwäche in der Herzgegend.
Modalitäten der subjektiven Herzbeschwerden können ausschlaggebend sein z.B. Stellungen, Bewegung, Schlaf, Wetter usw., aber auch nicht herzspezifische Umstände der Verschlechterung oder Verbesserung können hilfreich sein ( Kap. 4.2 )
Auslöser: Auslösende Faktoren der Erkrankung oder aber auch einzelner „Herzanfälle“ sind besonders zu verücksichtigen, z.B. Schreck, Sturz, Todesfall usw.
Begleitsymptome, die sich nicht am Herz manifestieren, sind unter Umständen wichtiger als die Herzsymptome selbst (z.B. Magen- oder Verdauungsstörungen, Schlafstörungen). Es ist deshalb besonders wichtig, den Gesamtzustand des Patienten zu erfassen.
Psychodynamik: Die Herzsymptome sind oft nur Teil eines neurotischen Komplexes, der meist eine Vorgeschichte und damit weitere verwertbare Symptome aufweist (definierte Ängste, depressive Verstimmungen etc.).
Miasmatische Zuordnung
Funktionelle Herzbeschwerden sind meist psorischer Natur: Herzklopfen mit Angst, morgens beim Erwachen, durch Ärger, nach Begeisterung oder Erregung, nach dem Essen, durch Freude/Kummer, vor den Menses, nach Schreck, beim Verdauen, durch Zorn. Gelegentlich spielt das tuberkulinische Miasma eine Rolle, wenn z.B. das Herzklopfen nur nachts beim Aufrichten auftritt.
Repertorium
Die Symptome funktioneller Herzbeschwerden sind meist noch mannigfaltiger als die der organischen. Neben den Lokalsymptomen der Herzsensationen, die in den Kapiteln „Angina pectoris“ ( Kap. 29.1.1 ), „Myokardinfarkt“ ( Kap. 29.1.2 ) und „Herzrhythmusstörungen“ ( Kap. 29.3 ) zu finden sind, müssen insbesondere die psychischen Symptome im Kapitel „Gemüt“ (mit Unterrubriken) berücksichtigt werden, die im Zusammenhang mit den Beschwerden stehen, beispielsweise:
Gemüt
Furcht – allgemein – Herz – Krankheit, vor
Furcht – allgemein – Herz – aufhören zu schlagen, werde
Wahnidee, Einbildung – Herz – Erkrankung haben und sterben, werde eine
Wahnidee, Einbildung – Herz – Herz oder Atmung würden aussetzen, oder versetzt sich anders in Schrecken, wodurch das Herz heftig schlägt
Angst – Herzklopfen – durch
Dosierung
Hohe C-Potenzen: C30, C200 und höher, gesteigert in Einzelgaben, nach der Kent’schen Reihe sind die Dosierung der Wahl.
Niedrige C-, D-, Q-Potenzen: Haben den Vorteil, dass die Patienten sie öfter einnehmen können, zeigen aber weniger klare Wirkung – und unterstützen den Kranken in seinem Glauben, nur gesund sein zu können, wenn er kontinuierlich Arzneimittel zu sich nimmt.
Q-Potenzen: Auch hier wirkt die kontinuierliche Arzneigabe eher kontraproduktiv, da sie den Patienten in seinem Glauben bestärkt, tatsächlich schwer krank zu sein (denn andernfalls müsste er ja nicht dauernd etwas einnehmen!).
Verlaufsbeurteilung
Oft beruhigt sich das Zustandsbild mit dem richtigen Arzneimittel, dann muss das Mittel nur noch selten wiederholt werden.
Es können zunächst auch andere Symptome in den Vordergrund treten. Dann muss sorgfältig abgewogen werden, ob der Verlauf den Hering’schen Regeln entspricht. Ggf. sind
Weitere Kostenlose Bücher