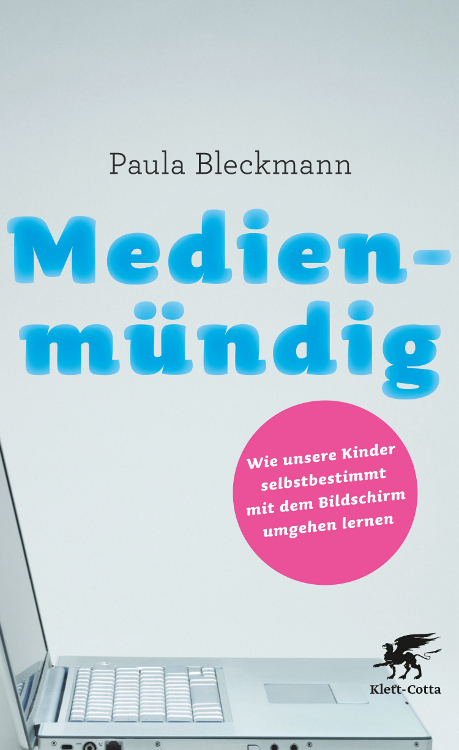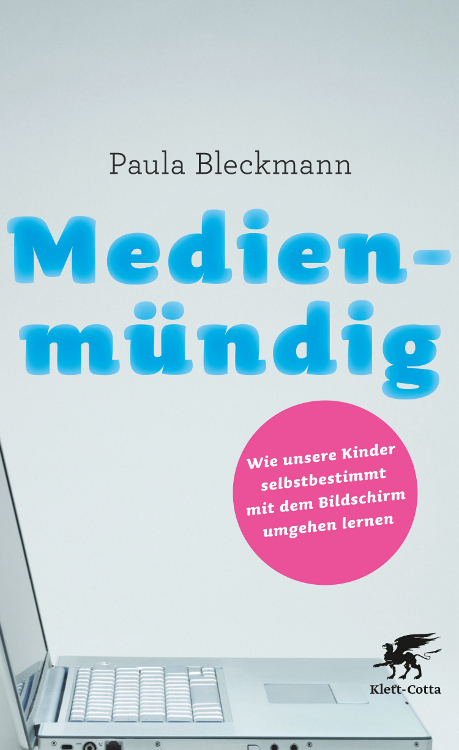
Medienmuendig
schneidet dagegen der Computereinsatz im Unterricht ab. Er ist einfach zu teuer, für das Wenige, was er bringt, jedenfalls wenn man in der Kosten-Nutzen-Bilanz die wahren Kosten der Computerisierung zugrunde legt. Die Frage nach dem Offenlegen versteckter Kosten ist für diesen systemvergleichenden Ansatz besonders wichtig. Armstrong und Casement stellen fest, dass die wahren Kosten schwer zu ermitteln sind, weil sie meist gleich dreifach unterschätzt werden: Bei den Anschaffungskosten springen Sponsoren ein, bei der Instandhaltungsind es allzu oft die Lehrer, die in ihrer Freizeit den Maschinenpark in Betrieb halten müssen. Am stärksten schlägt aber die Unterfinanzierung der Personalfortbildungen zu Buche. 70 Prozent eines ausgewogenen Unterrichtstechnologie-Budgets müssten in den Bereich der Lehrerschulung fließen, so rechnet Henry Jay Becker, Pädagogik-Professor an der Irvine-Universität in Kalifornien vor. Tatsächlich waren es in Amerika um die Jahrtausendwende nur 5 Prozent 99 .
Die Bilanz, die Armstrong und Casement ziehen, sieht daher so aus: Es gibt viele andere bessere und billigere Wege, etwas für die Bildung unserer Kinder zu tun.
Diese Alternativen verkümmern, weil so viel Geld in die Computerisierung des Unterrichts gesteckt wird, obwohl dies entweder keinen oder einen wesentlich geringeren Lernerfolg bringt. Sie beschreiben allerdings auch einzelne Bereiche, etwa den Einsatz von Rechtschreib-Trainingsprogrammen für Legastheniker, bei denen die Bilanz wesentlich besser aussieht.
Bei diesem historischen Streifzug wird deutlich, dass Medien für die Bildung meist nicht das gehalten haben, was sie versprachen. Aber zumindest dort, wo sie heute zum Berufsalltag gehören, muss man den Umgang mit Medien als Erwachsener natürlich beherrschen. Es gibt mehrere verschiedene theoretische Ansätze, in denen Wissenschaftler beschrieben haben, wie sie sich dieses »Beherrschen-Lernen« vorstellen, von der Bewahrpädagogik über die kritisch-emanzipatorische, die rezipientenorientierte und die produktionsorientierte Medienpädagogik. Sie haben alle sicher ihre guten Seiten und ihre wichtigen Anregungen. Der Streit der Schulen tobt bis heute. Der Schweizer Professor für Medienpädagogik Christian Doelker gehört zu den wenigen, die vorschlagen, das Kriegsbeil zu begraben. Warum muss denn die Frage lauten: Welcher Ansatz ist der richtige? Es muss gar nicht den einen richtigen Ansatz geben. Doelker fragt stattdessen: Welcher Ansatz ist für welches Alter geeignet? 100 Diese Idee habe ich zu einem eigenen Ansatz, dem entwicklungsphasenabhängigen Ansatz in der Medienpädagogik weiterentwickelt,der dem unten abgebildeten Turm zugrunde liegt. Es handelt sich dabei nicht um eine gänzlich neue Idee, sondern um die Weiterentwicklung alter, leider in Vergessenheit geratender guter Gedanken, hier zum Beispiel eine Forderung von Ende der 1980er:
Der Kindergarten hat die Erlebniskräfte des Kindes zu stärken, seine Persönlichkeitsentwicklung zu stabilisieren und ihm Grunderfahrungen zu vermitteln, die es später befähigen, ein autonomer Mediennutzer zu werden. […] In diesem Lebensraum haben Computer, Videospiele, Fernsehen und Filme keinen Platz. Eine Hineinnahme dieser Medien würde geradezu die Erziehung auf eine spätere autonome Nutzung dieser Medien unterlaufen. 101
Denken Sie dabei noch einmal an das Beispiel der sogenannten »Lauflernhilfe«, die den späteren aufrechten Gang erschwert. Auf die Reihenfolge kommt es an. Daher ist ein Turm für mich das passendste Bild dafür, wie man sich den Weg zur Medienmündigkeit vorstellen kann. Er sieht ähnlich aus wie ein Turm aus Bauklötzen, der Stockwerk für Stockwerk wächst. Je höher der Turm werden soll, desto breiter und stabiler muss die Basis sein. Beginnen wir also ganz unten, mit dieser breiten Basis, auf der alles Weitere aufbaut:
Die Welt mit allen Sinnen erfahren − Sensomotorische Integration
Im
ersten Stockwerk
geht es um etwas, das wir als Erwachsene eigentlich nicht verstehen können. Wir Erwachsenen haben nämlich große Schwierigkeiten, uns vorzustellen, wie ein kleines Kind die Welt wahrnimmt. Ich lade Sie aber herzlich zu einem kleinen
Experiment
ein, das diese Vorstellung erleichtert. Sie brauchen dazu ein beschriebenes Blatt Papier (zur Not dieses Buch) und eine zweite Person als Assistenten.
Nehmen Sie das Blatt in beide Hände und halten Sie es sich in etwa 20 Zentimeter Abstand von der Nasenspitze zunächstruhig vor
Weitere Kostenlose Bücher