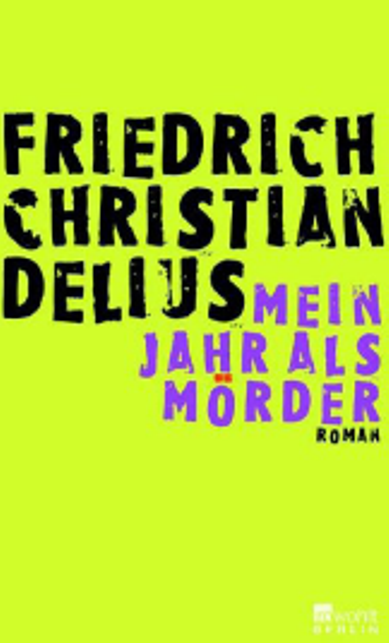![Mein Jahr als Mörder]()
Mein Jahr als Mörder
sorgfältigen Vorbereitungen hatte ich mich so weit konditioniert, dass ich mit der Rolle als Mörder, als der edle Böse völlig einverstanden war oder mir diese Eintracht einbildete. Nun atmete ich in hin und her schwankenden Gefühlen erleichtert auf, wegen des schwachen Herzens von R. mir die Auftritte auf der Bühne der Moral vielleicht doch sparen zu können.
Es folgte der schreckliche Monat September, ein einziger Albtraum, der mit einer schrillen Postkarte und einem begeisterten Brief von Catherine aus Mexiko begann. Sie schwärmte von Jacarandas, den Bäumen mit blauen Blüten, von schlafenden Schuhputzern, Feuerschluckern an den Kreuzungen, von den alten Gesichtern der jungen Leute, vom Urwaldklang der Pfeifen der Polizisten, von Staus und Fahrradrikschas. Sie hatte Mexikaner mit Pistolen erwartet, aber immer noch sei kein Schuss gefallen, den Popocatepetl habe sie bislang nicht fotografiert, und für die Fußball-Bundesliga schlug sie die Regel der Azteken vor: Die Sieger der Ballspiele werden den Göttern geopfert.
Nur wenige Tage nachdem ich ihren Brief gelesen hatte, von ihrem heiteren Enthusiasmus angesteckt, es war der 5. September, nachts gegen eins, rief Astrid aus Mexiko an. Catherine im Krankenhaus, schwer verletzt, sie seien unterwegs gewesen zum Indiomarkt in Tepotzlan, drei Jungens, halbe Kinder, hätten ihr die Kamera geraubt, sie sei ihnen nachgelaufen, an der nächsten Ecke hätten die ein Messer gezogen, ein Stich in den Bauch. Drei Stunden später rief Astrid wieder an, Catherine war tot.
Meine Gefühle für die Geliebte, die Tränen gehören nicht in dies Geständnis, auch nicht die Zeremonien des Abschieds, die ihre Familie in Marktredwitz organisierte. Ich habe nur von den Folgen zu berichten. In den Zuckungen der Trauer und im Taumel der Vorwürfe, Catherine allein gelassen zu haben in Mexiko, mochte ich von allem, was mit Mord und Töten und Sterben zu tun hatte, nichts mehr hören, nichts schreiben. Ich fühlte mich auf diffuse Weise mitschuldig, weil ich seit dem Nikolaustag den Gedanken an Mord freien Lauf gelassen hatte.
Kurz nach der Rückkehr von Catherines Beerdigung aus dem Fichtelgebirge hörte ich wie gewohnt die Abendnachrichten, es war der 18. September. Mit seinem warmen, verführerischen Bass meldete der Sprecher des RIAS: Wie erst heute bekannt wurde, ist der frühere Richter am Volksgerichtshof, R., am 15. September in einer Klinik im Allgäu einem Herzinfarkt erlegen. Damit, fügte er feierlich hinzu, als verneige er sich vor dem Schiedsrichter Tod, sei der Freispruch des Schwurgerichts Berlin rechtskräftig.
Ich wechselte den Sender und habe über die ganze Geschichte ungefähr dreißig Jahre lang kein Wort verloren.
Ein halbwegs glückliches Finale
Im September 1969 endete mein Jahr als Mörder. Nach dem Mord an Catherine und dem Tod R.s ließ ich das Thema von einem Tag auf den ändern fallen. Nichts brachte mich mehr an das Groscurth-Buch zurück, auch nicht die Sympathie für Georg und seinen Widerstand und für Anneliese und ihren Widerstand.
Aber die Geschichten rumorten weiter, wie seit den Kindertagen: Jetzt sah ich nicht nur den abgehackten Kopf, jetzt sah ich den Scharfrichter Röttger und seine Chefs, die Schlangenköpfe der Berliner Hydra, Havemann in verschiedenen Rollen, Frau Groscurth, wie sie Wehrdaer Wurst schneidet, von Freisler spricht oder von Humphrey Bogart schwärmt -Hunderte solcher Bilder drängten zur Darstellung.
«Ich stellte mich abseits von ihnen » - erst dieser Satz aus dem Tagebuch meiner Mutter ließ mich wieder anfangen: Das Abseits sollte vergolten, die ungeschriebene Geschichte eines Mörders erzählt, das Geständnis gewagt werden.
Die Verspätung hat viele Vorteile. Die Prozesse der Anneliese Groscurth ließen sich damals noch nicht vollständig rekonstruieren. Neu entdeckte Akten, neue Forschungen erleichtern die Beschreibung Georg Groscurths und seiner Gruppe Widerstand.
Und die Ärztin mit dem weiten Herzen? Nach der Eingabe von 1968, die zwischen drei prominenten Kanzleien, Kaul in Ostberlin, Heinemann jr. in Essen, Scheid in Westberlin, abgestimmt wurde, hat sie bis ins Jahr 1972 warten müssen. Die Ämter prüften, berieten, zögerten und boten endlich einen Vergleich an: Entschädigung werde sie nicht erhalten, aber die Witwenrente und die Söhne die Waisenrente, gemäß den
Bestimmungen. Rückwirkend jedoch nicht ab 1951, wie das Gesetz es vorschriebe, sondern ab 1960.
Sie stimmte zu. Über die Riesensumme,
Weitere Kostenlose Bücher