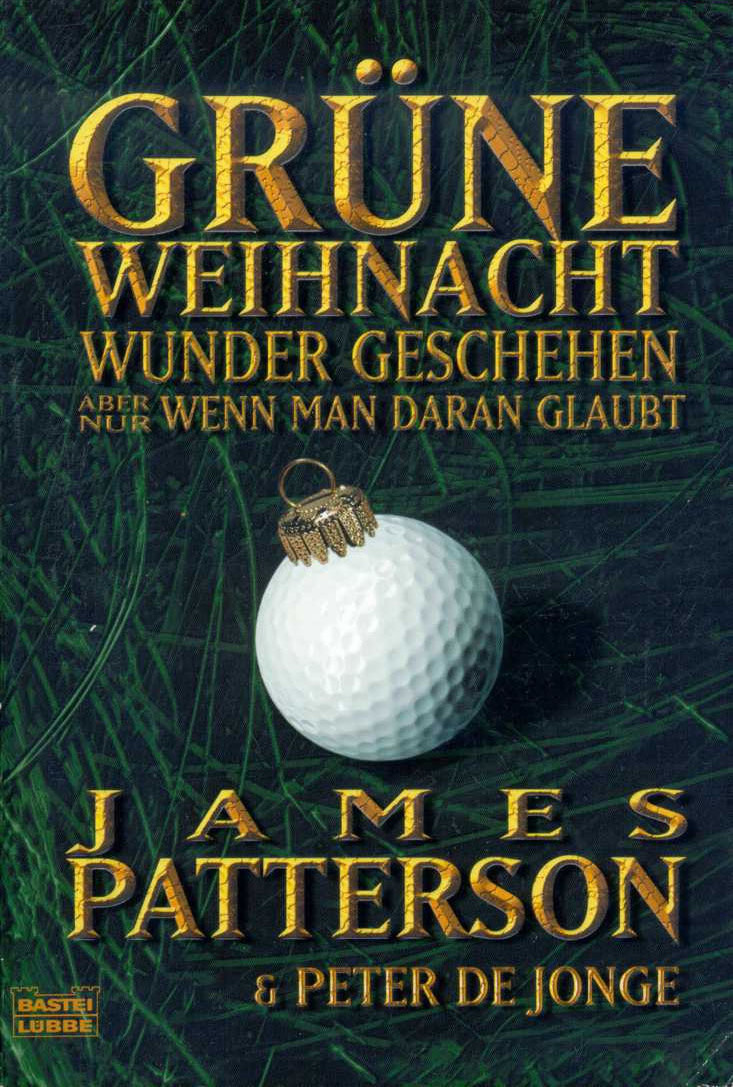![Patterson James]()
Patterson James
es gar nicht spitz, aber es
klang so.
»Und obendrein ist es auch noch was Langsames«, fügte ich
in scherzhaft lüsternem Ton hinzu, der bei weitem nicht so
sarkastisch gemeint war, wie er sich anhörte.
Die Band spielte »I Love Paris«, und zum ersten Mal seit
Monaten – zumindest schien es mir so, und wahrscheinlich
stimmte das auch – hielt ich Sarah im Arm, und wenn ich wohl
nicht behaupten kann, dass ich das Gefühl hatte, sie sei mein,
so fühlte es sich doch immerhin großartig an.
Ich blickte auf ihre Hand hinunter und dachte an den ersten
Tag unserer Flitterwochen in Kalifornien – als die Brandung ihr
den Verlobungsring vom Finger gespült hatte. Der Ring war
weg, aber Sarah bestand darauf, ihn nicht zu ersetzen. »Bei
jedem anderen Ring hätte ich das Gefühl, dass wir noch mal
neu anfangen«, erklärte sie, »und das tun wir nicht.« Das war
genau die exzentrische Sturheit, die ich an Sarah so liebte. Aber
vielleicht war es darüber hinaus auch ein Omen.
Und möglicherweise war es ein weiteres Omen, dass mitten
in unserem zweiten Tanz Sarahs Piepser losging. Bei einer ihrer
Patientinnen hatten die Wehen eingesetzt. Sie sollte das junge
Paar in fünfundzwanzig Minuten am Eingang zum Krankenhaus treffen.
»Springt denn niemand für dich ein heute Nacht?«, fragte ich
und hoffte, nicht gar zu niedergeschlagen zu klingen. Ich hatte
ihr noch immer nicht von der Q-School erzählt. Ich musste es
ihr doch erzählen. Wenn irgendjemand Verständnis dafür
hätte, dann Sarah. Ich meine, hatten wir uns denn nicht damals
ineinander verliebt, weil wir das Gefühl hatten, unsere Träume
miteinander teilen zu können?
»Nein, heute bin ich dran«, erwiderte Sarah. Offensichtlich
hatte sie freiwillig den Feiertagsdienst übernommen. Das war’s
dann also. Die Party war vorbei.
»Nun, du siehst jedenfalls hinreißend aus«, brachte ich mit
meinem tapfersten, törichtesten Lächeln hervor. »Irgend so ein
kleiner Scheißer wird einen bezaubernden Einstand feiern.«
Sarah setzte mich auf dem Weg ins Krankenhaus zu Hause
ab.
»Frohes neues Jahr, Travis. Tut mir Leid«, brachte sie noch
heraus.
»Ja-ah, mir auch«, sagte ich. »Frohes neues Jahr. Grüß den
neuen Erdenbürger von mir.«
Ich holte mir eine Flasche Wild Turkey aus dem Schrank und
hörte mir Sinatra an, der die Scheißsongs wenigstens richtig
sang.
Dann schlief ich auf der Couch ein und träumte von einer
Frau, die ein dunkelgrünes Kleid und goldene Ohrringe trug,
und mit der zu sprechen ich mir so sehnlichst wünschte, wie
Worte es nicht beschreiben können.
KAPITEL 8
A
ls der chromglänzende Aufzug ins achtundzwanzigste
Stockwerk des monolithischen Chicagoer Werbehochhauses
Leo Burnett 6c Company emporschwebte, konnte ich mich
eines angenehm prickelnden Gefühls, etwa so wie am ersten
Schultag, nicht erwehren.
Wunder waren auf der achtundzwanzigsten Etage nicht zu
erwarten, aber wem hätte ich auch noch etwas vormachen
wollen? Meine Karriere befand sich längst in einem Stadium, in
dem Wunder nichts mehr halfen.
Ich schätze, Leo Burnetts Firma gebührt zumindest Anerkennung dafür, dass sie sich so hartnäckig bemüht, freundlich
und heimelig zu wirken. Da sind die Obstkörbe mit leuchtend
roten Äpfeln in allen Empfangsbereichen. Das Buchgeschenk
zu Weihnachten mit einem Thema, für das man sich womöglich sogar vage interessiert. Die vom Vorsitzenden unterschriebene Glückwunschkarte zum Geburtstag. Aber, um ehrlich zu sein, dieses ganze Wir-sind-eine-große-Familie-Getue
hat bei mir immer schon Gruseln hervorgerufen, vergleichbar
mit einem gut sitzenden Haarimplantat, das eigentlich noch
schmieriger wirkt als ein schlechtes Toupet.
Trotz aller Annehmlichkeiten war Werbung für mich nie
mehr als ein Job gewesen. Oder ein schrecklicher Irrtum. Ein
Fehler, den ich irgendwie nie wieder ausbügeln konnte.
Das Hinterhältige an der Werbebranche ist: Die Arbeit erfordert so wenig Produktivität, dass man für jede andere Art
von Job unbrauchbar wird. Mit einer einzigen, richtig guten
Idee im Jahr wird man schon zu einem wertvollen Bestandteil
der Firma. Eine im Monat, und man geht auf Wolken. In welchem anderen Job, mit Ausnahme vielleicht von Politik und
Drehbuchschreiben, kann man es sich schon leisten, fünf Jahre
lang tagtäglich zur Arbeit zu gehen und dabei praktisch fast
nichts vorzuweisen – und bekommt dennoch immer seinen
Gehaltsscheck? Natürlich steckt genau darin die Tücke. Denn
wenn deine Zeit abgelaufen ist, dann können
Weitere Kostenlose Bücher