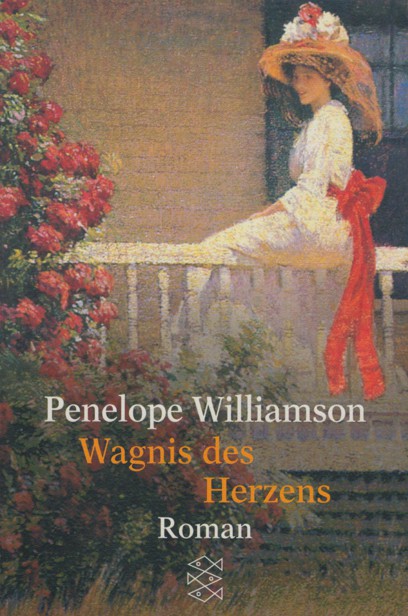![Penelope Williamson]()
Penelope Williamson
Jahreszeiten verändern würde, aber das geschah nie.
Ein Zweig knackte, sie zuckte
zusammen und fuhr herum. Ein Pferd trabte durch das Gras. Es war das
Hellbraune. Sein Reiter war mit Schlamm bespritzt.
Sie wartete schüchtern und doch
seltsam unbeschwert, bis er sie erreicht hatte. Als er nahe genug herangekommen
war, zog sie aus der Satteltasche ein weißes Leinentaschentuch, beugte sich zur
Seite und wischte ihm die Schlammspritzer vom Gesicht. Dabei wagte sie sogar,
ein wenig zu spotten.
»Ich habe gehört, daß man sein
Herz verlieren kann, aber doch nicht den Kopf«, sagte sie.
Geoffrey
Alcott lachte und schüttelte den Kopf. »Du reitest, als würde hinter dir die
Welt in Schutt und Asche versinken, Emma. Eines Tages wirst du dir noch den
Hals brechen ... oder ich, wenn ich versuche, mit dir Schritt zu halten.«
Sie richtete sich auf. Dabei
fiel ihr Blick auf das Taschentuch, das sie in der Faust zerknüllte. Gewiß, er
hatte bei seinen Worten gelacht, aber ihr entging der Anflug der Vorwurfs
nicht. Sie wußte, daß es sich nicht schickte, was sie getan hatte. So durfte
eine Dame nicht reiten. Aus dem Wald hörte sie das aufgeregte Bellen der Meute
und dann zwei langgezogene Töne des Jagdhorns. Das bedeutete, die Hunde hatten
die Fährte verloren. Es freute sie, denn diesmal wollte sie, daß der Fuchs
entkam.
»Emma ...«
Sie blickte noch immer auf ihre
Hände, aber sie bemühte sich, unbekümmert, ja sogar kokett zu klingen, obwohl
sie darin nicht sonderlich begabt war.
»Ach du liebe Zeit! Jetzt
machst du mir Vorwürfe, weil ich ohne Grund Mauern, Zäune und Hecken
überspringe, anstatt brav den Hunden zu folgen.«
»Heirate mich, Emma.«
Sie glaubte,
ihr sei das Herz stehengeblieben. Und wirklich, es hatte einen Schlag
ausgesetzt. Als es wieder klopfte, fühlte sie das unruhige Pochen bis zum Hals.
Auf diesen Augenblick hatte sie seit Monaten gewartet. Jetzt war es soweit, und
sie wußte nicht, wie sie damit umgehen sollte.
Schließlich wagte sie es, ihn anzusehen.
Seine Augen waren so grau wie Eis auf einem See. Das
blaßbraune Haar hatte die Farbe von Tee, auf den die Sonne fiel. Er galt
allgemein als gutaussehender Mann. Sie kannte Geoffrey schon so lange und wußte
beim besten Willen nicht, ob sie ihn liebte oder nicht. »Ich hatte nicht vor,
damit einfach herauszuplatzen«, sagte er. »Willst du deinen Antrag
zurücknehmen?«
»Nein!«
Er
lächelte sie schuldbewußt an. Wenn er lächelte, sah er nicht so gut aus, denn
er hatte lange, etwas vorstehende Zähne. Aber Emma mochte an ihm vor allem sein
Lächeln. Es hatte einen Anflug von liebenswerter Wehmut, bei der es ihr warm
ums Herz wurde, als ob sie beide ein besonderes Geheimnis teilten.
»Ich bin
bereit, es von allen Dächern zu rufen, wenn es sein muß«, sagte er. »Obwohl ich
nicht unbedingt möchte, daß die ganze Welt deine Antwort hört ..., für den
Fall, daß du mich nicht abweist.« Aber damit rechnete er nicht wirklich, das
konnte sie an seinem besitzergreifenden Blick sehen. Seine Augen leuchteten
erwartungsvoll, und es lag noch etwas in ihnen, etwas Ungezähmtes, Starkes,
eine Art Leidenschaft, die sie erschrecken ließ, aber sie auch erregte. Emma
fragte sich, ob er jetzt sagen würde, daß er sie liebte. Wahrscheinlich gab es
dafür eine feste Reihenfolge im Katalog der Regeln, die ihrer beider Leben so
nachdrücklich beherrschten. Wann war der Augenblick gekommen, an dem er diese
Worte zum ersten Mal aussprechen konnte? Vielleicht durfte er ihr in der Hochzeitsnacht
seine Liebe gestehen. Das hoffte sie, denn in der Welt, in der sie lebten,
schien es oft so, als sei nach einem oder zwei Jahren Ehe nur wenig Liebe
übrig, die man hätte gestehen können.
»Emma«,
sagte er noch einmal, und diesmal klang es ungeduldig. Sie konnte ihn nicht
mehr ansehen, aber sie spürte seinen Blick auf sich ruhen, auf ihren Lippen,
als versuche er, die entscheidenden Worte von ihr zu erzwingen. Geoffrey war
bekannt dafür, daß er alles bekam, was er wollte – und offensichtlich wollte er
sie haben. »Vermutlich hätte ich zuerst in aller Form bei deinem Vater um deine
Hand anhalten müssen, aber da er nicht hier ist und wir uns schon so lange
kennen ... Du bist bereits zweiundzwanzig. Wir schreiben das Jahr 1890, und du
bist ein modernes Mädchen, deshalb habe ich gedacht ...«
Emma ließ
den Kopf sinken, um ein Lächeln zu verbergen. Geoffrey Alcott redete aus
Verlegenheit. Hielt er sie wirklich für ein »modernes« Mädchen?
Weitere Kostenlose Bücher