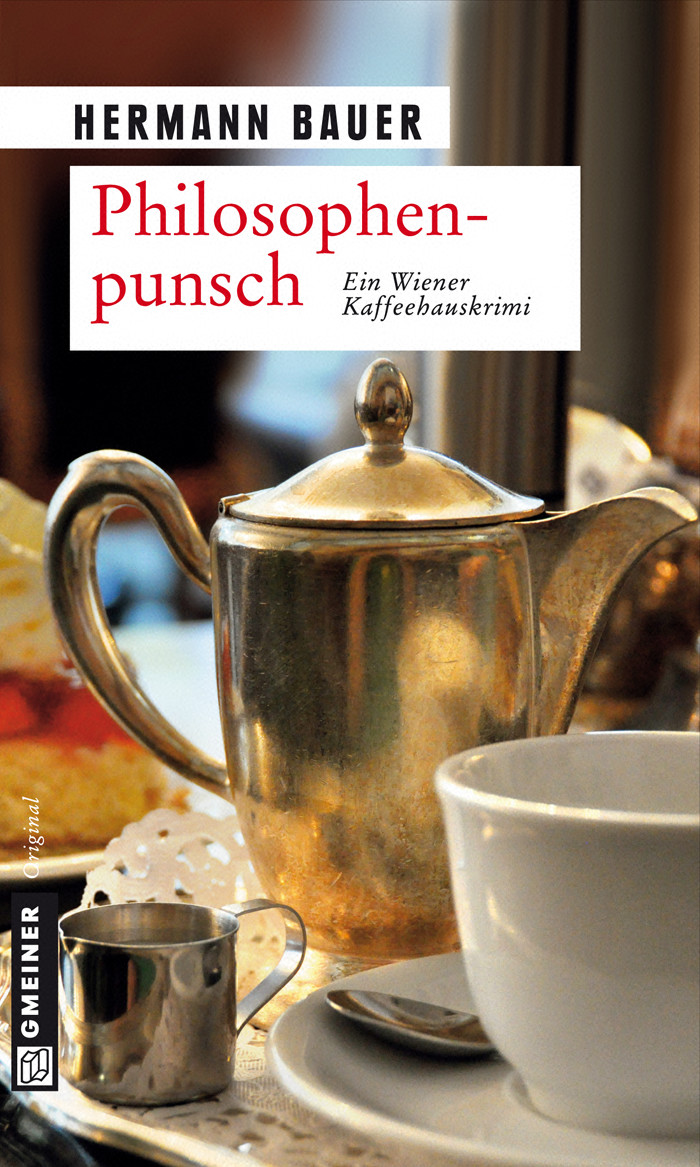![Philosophenpunsch]()
Philosophenpunsch
ansprechen konnte. Aber dass sie sich so widerspenstig zeigen würde, hatte er nicht erwartet. Er hatte gehofft, dass es bei ihr einfacher sein würde als bei den anderen.
Das Gegenteil war der Fall gewesen. Geschrien hatte sie, so laut, dass man ihr die Luftzufuhr absperren musste, um das Ärgste zu verhindern. Natürlich hatte man sie gehört. Die beiden alten Weiber mit ihrem kläffenden Köter hatten sie gehört. Also war er gezwungen gewesen, loszulassen. Zunächst einmal. Und dann …
Jetzt hatte er die Scherereien. Er hatte nicht mit all den Komplikationen gerechnet. Wenn er wenigstens bis nach Weihnachten seinen Verfolgern entgehen konnte, dann war schon viel gewonnen. Noch hatten sie ihn nicht. Es hieß bloß, kühlen Kopf bewahren.
Er musste Geduld haben und warten. Falls alles gut ging, würde er es wieder versuchen, nicht heute oder morgen, aber in absehbarer Zeit. Zumindest dessen war er sich absolut sicher. Er konnte nicht anders.
Sie waren immer selbst schuld …
*
Leopold fuhr gemächlich in Richtung Kaffeehaus zurück. Er hatte es nicht eilig. Er hatte seine Tante fürs Erste mit seiner Wohnung vertraut gemacht und konnte nur hoffen, dass er bei seiner Rückkehr alles halbwegs so vorfinden würde, wie er es verlassen hatte. Dann war er kurz wegen eines Phantombildes des Glatzkopfs auf dem Kommissariat gewesen. Nun blieb ihm noch ein kleiner Zeitpolster, den zu nützen er entschlossen war. Denn er durfte seinen Dienst aufgrund der besonderen Umstände an diesem Nachmittag ein wenig später als sonst antreten.
So hatte er sich vorgenommen, noch einen Sprung im Bekleidungsgeschäft ›Schick beim Frick‹ vorbeizuschauen. Er hätte nur zu gern gewusst, welche Beziehung zwischen dem Mann namens Mario und dem Mordopfer bestanden hatte und weshalb er am Vortag so sehr aus der Fassung geraten war. Außerdem war der Kerl dem Kaffeehaus noch 19,20 Euro schuldig, und das bei einer Kreditwürdigkeit, die man ruhig gleich null einstufen konnte.
Also ließ Leopold sein Auto kurz beim Frick stehen und ging hinauf in den ersten Stock in die Herrenabteilung. Die ganze Umgebung kam ihm vertraut und doch seltsam fremd vor. Es geschah nämlich nicht oft, dass Leopold Gewand für sich einkaufen ging. Mit seiner Dienstlivree – dem weißen Hemd, schwarzen Anzug und dem Mascherl – war er seit Jahren auf Du und Du. Da passte alles wie angegossen. Vor einiger Zeit hatte eine kleine Änderung vorgenommen werden müssen, weil Leopold um die Leibesmitte ein wenig rundlicher geworden war, das war’s aber auch schon gewesen. Diese Dienstkleidung bedeutete ihm viel, sie war sein Erkennungszeichen nach außen, eine Uniform, die ihn als Respektsperson kennzeichnete, als Hüter der Ordnung in einer Institution, die streng auf die Einhaltung bestimmter Regeln achtete: im Kaffeehaus.
Wie er sich nun aber außerhalb des Kaffeehauses, sozusagen privat, zeigte, das war Leopold egal. Gewand war da, um getragen zu werden, und zwar möglichst viele Jahre lang. Natürlich, ordentlich und sauber musste es sein, darauf legte Leopold größten Wert. Aber gleichzeitig sollte es etwas Zeitloses an sich haben, mit dem man alle Modetorheiten gekonnt umschiffte und es sich so ersparte, für ständigen Zukauf sorgen zu müssen. Denn Leopold hasste den Kleidungserwerb. Er hasste die Notwendigkeit, in einer Umkleidekabine ständig von einer Garnitur in die andere zu schlüpfen. Er hasste die Verkäufer, die einem immer ein noch teureres Stück aufschwatzen wollten, auch wenn man sich schon längst für etwas entschieden hatte. Und er hasste es, sich nach dem Kauf an so ein neues Wäschestück gewöhnen zu müssen. Geradezu peinlich, wenn man sich darin im Spiegel ansah. Man hätte es doch nicht nehmen sollen. Warum konnte man nicht tagein, tagaus, wo immer man sich auch befand, den guten alten Kaffeehausanzug tragen? Da würde einem eine Menge erspart bleiben.
»Der Herr wünschen?«, säuselte ihm auch schon ein junges, gestyltes Bürschchen ins Ohr. Glücklicherweise sah er in diesem Augenblick das Ziel seines kurzen Abstechers bei einer Kleiderstange stehen: Mario Schweda, dessen Namen er jetzt deutlich auf einer Plakette lesen konnte. So ließ Leopold das Bürschchen Bürschchen sein und ging geradewegs auf Mario zu.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Mario Schweda vorsichtig und blickte ihn dabei aus kleinen, rotgeränderten Augen an. Die vorige Nacht stand ihm noch deutlich ins Gesicht geschrieben.
»Ich weiß nicht,
Weitere Kostenlose Bücher