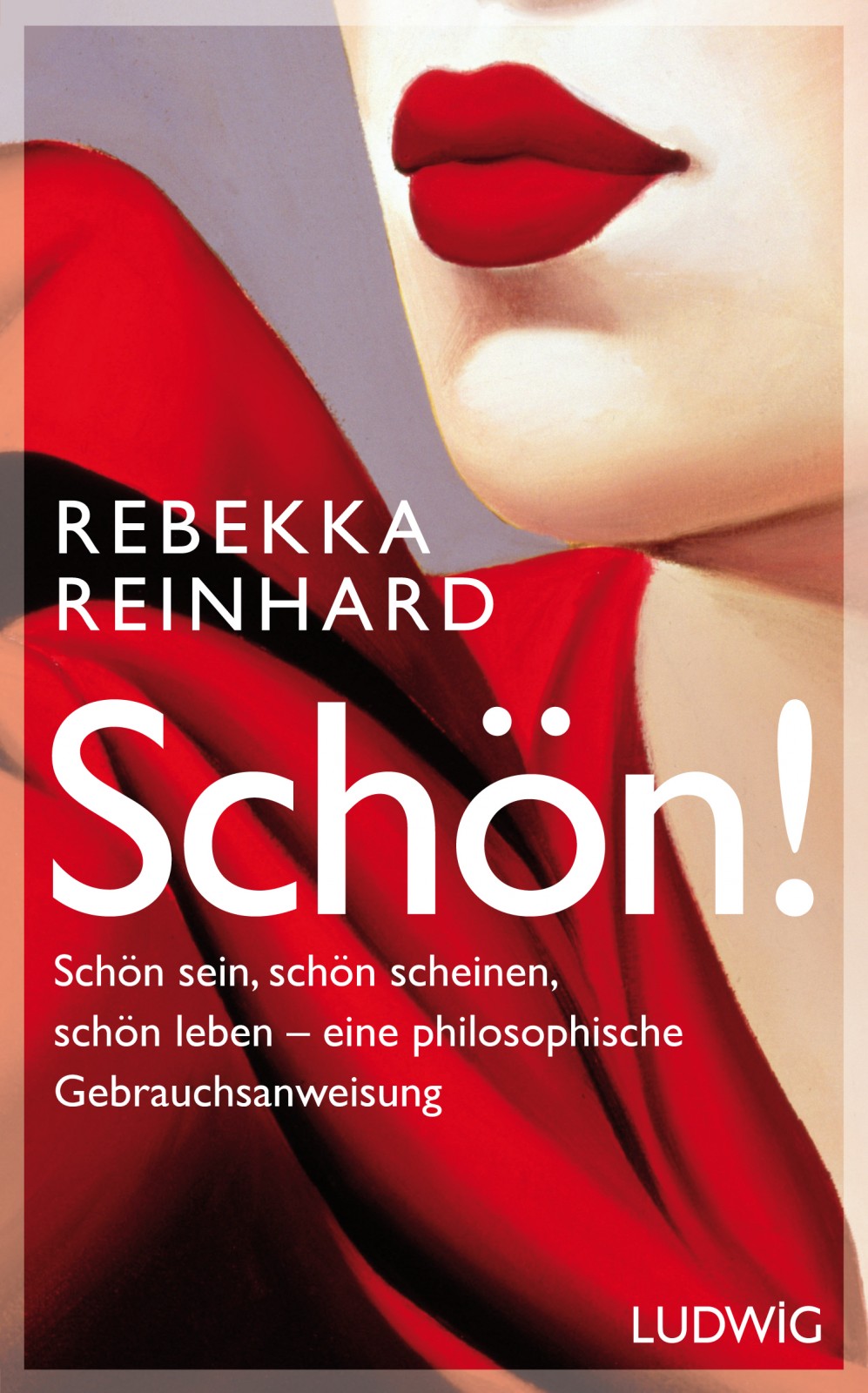![SCHÖN!]()
SCHÖN!
gestalten. Also empfiehlt es sich, von allen schönen Körpern einen Teil auszuwählen, der gelobt wird.«
Ebenso prägend wie seine architektonischen Schriften ist Vitruvs Theorie vom wohlgeformten Körper, dessen Maß- und Zahlenverhältnisse Leonardo da Vinci ( 1452 – 1519 ) in seiner Zeichnung des »vitruvianischen Menschen« verewigt und an denen sich auch Albrecht Dürer ( 1471 – 1528 ) orientiert.
Da je nach Perspektive aber ein anderes Bild von einem schönen Raum oder einem schönen menschlichen Körper entsteht, ist nicht mehr klar, ob es überhaupt noch einen absoluten Maßstab für das Schöne geben kann (wie es für Pythagoras die Zahl oder für Platon die Idee des Schönen war) – oder ob Schönheit nun eine Frage des subjektiven Standpunkts ist. Dürer bringt dieses Problem so auf den Punkt:
»Ein schönes Bild zu machen, kannst du von einem Menschen nit abnehmen. … Das Schöne zu beurteilen, davon ist zu ratschlagen. Nach Geschicklichkeit muss man sie in ein jeglich Ding bringen … Schön und schöner ist uns nit leicht zu erkennen. Denn es ist wohl möglich, dass zwei unterschiedliche Bild gemacht werden, keines dem anderen gemäss, dicker und dünner, dass wir nit wohl beurteilen können, welches schöner sei. Die Schönheit, was das ist, das weiss ich nit; wiewohl sie vielen Dingen anhangt …«
Die Ratlosigkeit Dürers führt zurück zu den Fragestellungen in Platons Hippias . Seine Überlegungen markieren aber auch den Übergang in eine neue Epoche, in der die unterschiedlichen (künstlerischen) Realisierungsmöglichkeiten und die Vielfalt der individuellen Erfahrungen des Schönen in den Mittelpunkt des Interesses treten.
Schönheit: eine Geschmackssache
Im 18 . Jahrhundert geht es nicht mehr um die Suche nach dem absoluten oder objektiven Schönen, sondern um das, was subjektiv gefällt. Schönheit wird nicht mehr mit Wahrheit oder messbarer Gesetzmäßigkeit gleichgesetzt, sondern mit sinnlicher Empfindung und Instinkt. Sie wohnt einem Gegenstand nicht mehr inne, sondern liegt im Auge des Betrachters. Wie der schottische Philosoph David Hume ( 1711 – 1776 ) 1757 schreibt: »Schönheit ist keine Qualität in den Dingen selbst; sie existiert lediglich im Geist dessen, der sie betrachtet; und jeder Geist nimmt eine andere Schönheit wahr … Über Geschmack lässt sich nicht streiten.«
Allerdings gibt Hume zu, dass die meisten Menschen den gleichen Geschmack haben, wenn sie individuell beurteilen, was sie schön finden. Er geht deshalb davon aus, dass unseren Beurteilungen ein »Schönheitssinn« zugrunde liegt, den man trainieren kann – auch wenn nur wenige Experten in ihrem Urteil so sicher seien, dass ihr Empfinden eine »Geschmacksnorm« begründen könne. Was darauf schließen lässt, dass die subjektive Beurteilung des Schönen eben doch nicht ganz ohne Maßstab auskommt.
Im selben Jahr veröffentlicht der englische Philosoph und Politiker Edmund Burke ( 1729 – 1797 ) das Standardwerk Philo sophische Untersuchungen über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen . Darin widmet er sich der Frage, welche äußeren Reize welche ästhetischen Empfindungen in uns auslösen. Jedes Mal, wenn der Mensch mit Schmerz, Gefahr oder Tod zu tun hat, so Burke, überkommt ihn das schreckliche Gefühl des »Erhabenen« (das auch angenehm sein kann, solange die Bedrohung nicht real ist. Denken wir an den woh ligen Grusel beim Krimilesen!). Liebe und Sexualität assoziiert er dagegen mit dem – schwächeren – Reiz des »Schönen«. Burkes Hervorhebung des Erhabenen gegenüber dem Schönen wird in der Kunst(theorie) des 20 . Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielen.
Für Hume und Burke ist Schönheit zwar eine individuelle, subjektive, sinnliche Geschmackssache, aber nichts völlig Beliebiges. Darin stimmen sie mit Immanuel Kant ( 172 4 – 1804 ) überein, der mit seiner Kritik der Urteilskraft die wichtigste Untersuchung zur Bestimmung des Schönen seiner Zeit vorlegt. Sein Werk gehört zu der im 18 . Jahrhundert neu etablierten philosophischen Disziplin der Ästhetik (von griechisch aisthesis für »sinnliche Wahrnehmung«), die sich dem schönen Kunstwerk, dem Geschmack und dem ästhetischen Werturteil widmet.
Laut Kant kann nur ein Gegenstand, dem man »interesse loses Wohlgefallen« entgegenbringt, als schön empfunden wer den. Wer beispielsweise beim Anblick gemalter Äpfel Hunger bekommt, kann nicht beurteilen, ob das Stillleben schön ist oder nicht – sein
Weitere Kostenlose Bücher