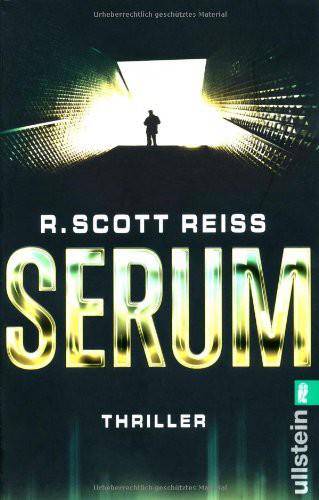![Serum]()
Serum
diesem Namen schrillten meine Alarmglocken. Ich verstand zwar immer noch nicht, wessen ich mich schuldig gemacht haben sollte, aber jetzt wusste ich, um wen es ging, und das erfüllte mich mit Angst. Ich sah sie noch vor mir, ein schmales, dunkelhaariges Mädchen im schwarzen Bikini, das sich am Atlantikstrand sonnte, während ich ihr die gebräunten Schultern mit Coppertone-Sonnenöl einrieb. Ich erinnerte mich an ihr herzförmiges Gesicht, wenn wir uns im Partykeller ihrer Eltern in Devil’s Bay liebten.
»Sie fuhr einfach über die Kreuzung«, sagte die Stimme. »Der Lastwagen hat sie seitlich gerammt.«
Pam Grano war ein Mädchen, in das ich schon auf der Highschool verknallt war, aber wir kamen erst nach meinem Jurastudium zusammen, als ich beim FBI anfangen wollte. Unsere gemeinsame Zeit war kurz und leidenschaftlich, und ich vermisste Pam, als ich nach Washington umzog. Wir schrieben uns und telefonierten, doch eines Tages teilte sie mir dann einfach mit, dass sie jemand anderen kennengelernt hätte.
»Du hast sie sitzenlassen«, sagte die Anruferin jetzt.
»Du bist ihre Schwester«, sagte ich. »Tia.«
»Als sie im Krankenhaus ankam, war sie schon tot.«
Jetzt erinnerte ich mich auch an Tia, genauso hübsch wie ihre Schwester, aber aus irgendeinem Grund von einem tiefsitzenden Groll erfüllt, auf Eltern, Jungs, Freunde, alle Welt. Tia war schon mit 23 verbittert gewesen.
»Euch Männern ist es egal, wenn ihr einem das Leben ruiniert«, sagte sie.
»Tia, es tut mir leid. Das muss schrecklich für dich sein. Aber ich verstehe nicht, warum du mir die Schuld gibst.«
»Ein echter Vater wäre selbst am Steuer gesessen. Aber Pam musste den Jungen ja ganz alleine großziehen.«
»Ein Vater?«, wiederholte ich, und meine Stimme klang plötzlich wie aus weiter Ferne.
»Paul wurde in Stücke gerissen. Er ist verblutet. Pam wollte ihn zum Fußballtraining fahren. Du hast dich ja nie um ihn gekümmert.«
Manchmal kommt etwas so unerwartet, dass sich das ganze Universum zu verschieben scheint. Vergangenheit und Zukunft ordnen sich neu und zwingen das Leben in eine andere Bahn. Zu erfahren, dass das eigene Kind tot ist, muss der schlimmste Schock der Welt sein. Und dass ich bis zu diesem Augenblick nicht einmal von seiner Existenz gewusst hatte, machte es nur noch schlimmer.
Mir schwindelte. Mein Herz schien stillzustehen. Ich erinnere mich noch, wie ich eine Schabe über den Boden kriechen sah und eine Sirene draußen fern und unpersönlich heulte. Die Gardine hing schief. Das Wochenende, von dem ich gerade zurückgekehrt war – mein Techtelmechtel in den Berkshires –, kam mir plötzlich wie eine Farce vor, sinnlos, ohne jede Bedeutung.
»Sie hat uns verboten, dir von Paul zu erzählen«, sagte Tia. »Aber jetzt kann sie mich nicht mehr daran hindern.«
In ihrer Trauer wäre es sinnlos gewesen, ihr zu widersprechen. Ungläubig dachte ich: Ich hatte einen Sohn?
»Wann ist die Beerdigung, Tia?«
Später lag ich im Bett, umgeben von den Attributen meines Erfolgs: dem Abonnement fürs Lincoln Center, Quittungen von Edelrestaurants, Maßanzüge von Armani, Ticketabschnitte vom Yankee-Stadion. Ja, mein Leben war großartig. Ohne Familie reicht ein FBI-Gehalt erstaunlich weit.
Wie hat mein Sohn wohl ausgesehen?, überlegte ich. Liebte er Baseball? War er gut in der Schule?
Am Tag der Beerdigung trug ich schwarz und wappnete mich für die Begegnung mit der Familie. Ich nahm die U-Bahn nach Brooklyn statt ein Taxi. Der Zug der Linie F schwankte über die Hochtrasse. Hier war ich als Teenager manchmal am Wochenende nach Manhattan gefahren, wenn mein Vater wieder mal einen geplanten Ausflug abgesagt hatte.
Aber ich konnte ihm nie richtig böse sein.
»Mom fühlt sich nicht gut«, sagte er an solchen Tagen, während ich sie im Badezimmer in ihrem Rollstuhl würgen hörte.
»Ich kann heute nicht mit«, meinte er dann. »Hier hast du einen Zwanziger. Mach dir einen schönen Tag.«
Als Junge hatte ich mich um sie gekümmert, fast jeden Nachmittag nach der Schule. Holte Arznei. Fuhr sie im Rollstuhl am Meer entlang. Las ihr vor. Sie liebte FBI-Romane.
Ich möchte auch ein FBI-Mann werden wie die in den Büchern, dachte ich, während ich Bettpfannen auswusch oder mit ihr zusammen fernsah.
»Geh aufs College«, sagte sie immer. »Weit weg. Du hast mehr für mich getan als zehn andere zusammen. Und verschwende dein Leben nicht damit, dich um einen kranken Menschen zu kümmern, wie dein Vater. Wähle deine Frau
Weitere Kostenlose Bücher