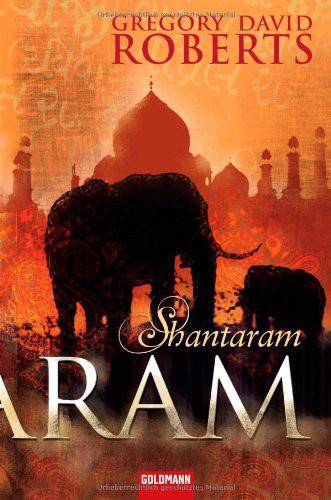![Shantaram]()
Shantaram
Heimat?
Erst als ich mir diese Frage stellte, wurde mir klar, dass ich die Antwort bereits wusste. Wenn ich überhaupt eine Heimat, ein Land meines Herzens hatte, dann war es Indien. Ich war ebenso ein Flüchtling, ein Vertriebener und Staatenloser wie Tausende von Afghanen, Iranern und anderen, die alle Brücken hinter sich abgebrochen hatten; jene Exilanten, die sich darangemacht hatten, ihre Vergangenheit mit der Schaufel der Hoffnung in der Erde ihres eigenen Lebens zu begraben.
»Ich bin Australier«, antwortete ich, gab es zum erstenmal seit meiner Ankunft in Indien zu, einem Instinkt folgend, dass ich Khaderbhai gegenüber ehrlich sein sollte. Seltsamerweise kam mir die Wahrheit wie eine noch größere Lüge vor als jeder Deckname, den ich bis dahin angenommen hatte.
»Das ist ja sehr interessant«, bemerkte Abdul Ghani mit hochgezogener Augenbraue und einem vielsagenden Nicken in Khaderbhais Richtung. »Und welches Thema schlägst du vor, Lin?«
»Habe ich freie Wahl?«, fragte ich, um Zeit zu gewinnen.
»Ja, das bleibt ganz dir überlassen. Letzte Woche haben wir über den Patriotismus diskutiert – welche Verpflichtungen man gegenüber Gott hat und was man seinem Land schuldig ist. Ein ausgezeichnetes Thema. Was meinst du? Worüber sollen wir diese Woche diskutieren?«
»Na ja, auf dem Plakat von Sapna gibt es eine Zeile … unser Leid ist unsere Religion, lautet sie, ungefähr wenigstens. Das hat mich an etwas erinnert: Vor ein paar Tagen hat die Polizei eine Menge Häuser im Zhopadpatti niederreißen lassen, und während wir zusahen, hat eine Frau neben mir gesagt … Es ist unsere Pflicht, zu arbeiten und zu leiden, so was in dem Sinn. Sie sagte das ganz ruhig und schlicht, als hätte sie sich damit abgefunden, als würde sie es akzeptieren und sogar Verständnis dafür haben. Aber ich verstehe das nicht, und ich glaube auch nicht, dass ich es je verstehen werde. Vielleicht könnten wir ja darüber sprechen: Warum Menschen leiden? Warum schlechte Menschen so wenig leiden? Und warum gute Menschen so furchtbar leiden müssen? Also, damit meine ich natürlich nicht mich selbst – das Leid in meinem Leben habe ich größtenteils selbst zu verantworten. Und ich habe weiß Gott viel Leid über andere gebracht. Aber ich verstehe es trotzdem nicht – insbesondere das Leid der Menschen im Slum. Also … das Leid … wir könnten über das Leiden reden … Oder nicht?«
Meine Worte verhallten in dem Schweigen, mit dem mein Vorschlag zur Kenntnis genommen wurde. Die Stille dauerte jedoch nur einen Augenblick, dann belohnte Khaderbhai meinen Vorschlag mit einem herzlichen, beifälligen Lächeln.
»Das ist ein gutes Thema, Lin. Ich wusste, dass du uns nicht enttäuschen würdest. Madjidbhai, dürfte ich dich bitten, das Gespräch zu eröffnen?«
Madjid räusperte sich und wandte sich seinem Gastgeber mit einem verdrießlichen Lächeln zu. Er strich sich mit Daumen und Zeigefinger über die buschigen Augenbrauen und eröffnete die Diskussion dann mit dem Selbstvertrauen eines Menschen, der es gewohnt ist, seine Meinung zu äußern.
»Das Leid – mal sehen. Ich glaube, dass Leiden eine freie Willensentscheidung ist. Und dass wir in diesem Leben nichts erleiden müssen, was wir nicht wollen, solange wir stark genug sind, es zu verweigern. Der Starke beherrscht seine Gefühle voll und ganz, sodass es fast unmöglich ist, ihm Leid zuzufügen. Wenn wir tatsächlich leiden, seien es nun Schmerzen oder sonst etwas, dann bedeutet das, dass wir die Kontrolle verloren haben. Ich sage also, dass Leiden eine menschliche Schwäche ist.«
»Achaacha«, murmelte Khaderbhai, die Wiederholungsform des Wortes gut auf Hindi, was sich ungefähr mit gut gemacht oder großartig übersetzen lässt. »Deine interessante These wirft für mich allerdings gleich die nächste Frage auf: Woher kommt diese Stärke?«
»Woher?«, grunzte Madjid. »Das weiß doch jeder: daher, dass … na ja… was willst du damit sagen?«
»Nichts, alter Freund. Nur: Stimmt es nicht, dass unsere Kraft zum Teil erst aus dem Leid erwächst? Dass das Leiden uns stärker macht? Dass Menschen, die nie wahre Not erlebt, nie wirklich gelitten haben, nicht so stark sein können wie diejenigen, die viel gelitten haben? Und wenn das stimmt, läuft dann dein Argument nicht darauf hinaus, dass wir schwach sein müssen, um zu leiden, dass wir andererseits aber leiden müssen, um stark zu sein, was wiederum bedeuten würde, dass wir schwach sein müssen, um
Weitere Kostenlose Bücher