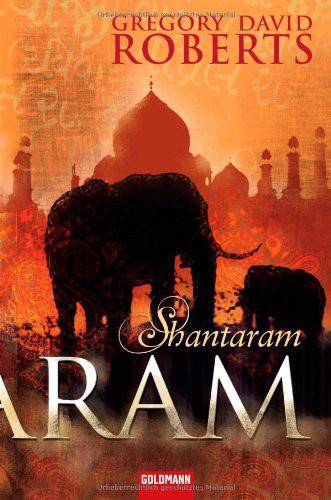![Shantaram]()
Shantaram
sofort auf. Wir entschieden uns für den längeren Weg zu ihrem kleinen Haus und spazierten an der Ufermauer entlang, die sich vom Gateway of India bis zum Radio Club Hotel am Meer erstreckt. Die breite Straße war leer. Zu unserer Rechten, hinter einer Platanenallee, befanden sich Hotels und Apartmenthäuser. Manche Zimmer waren beleuchtet, sodass man hineinsehen konnte und einen Eindruck vom Leben der Bewohner bekam: eine Skulptur an einer Wand, ein Bücherregal an einer anderen, ein holzgerahmtes Poster von einer indischen Gottheit, von Blumen und glimmenden Räucherstäbchen flankiert, und, am Rande eines Parterrefensters, zwei schmale Hände, zum Gebet gefaltet.
Zu unserer Linken befand sich ein Teil des größten Hafens der Welt. Die Ankerlichter zahlloser Schiffe glitzerten, Sternen gleich, auf dem dunklen Wasser. Dahinter erzitterte der Himmel von den Flammen, die aus den Fackeln der ins Meer vorgelagerten Raffinerien loderten. Die Nacht war mondlos. Obwohl es auf Mitternacht zuging, schien die Luft sich seit dem Nachmittag nicht abgekühlt zu haben. Es herrschte Flut, und vom Arabischen Meer trieb immer wieder Sprühnebel über die hüfthohe Steinmauer: Dunstschleier, die der Samum von der afrikanischen Küste bis hierher trug.
Wir gingen langsam. Ich blickte oft zum Himmel auf, an dem zahllose Sterne glitzerten, ein schwerer funkelnder Fang im schwarzen Netz der Nacht. Wenn man im Gefängnis sitzt, lebt man jahrelang ohne Sonnenaufgang, ohne Sonnenuntergang und ohne den Nachthimmel, ist sechzehn Stunden am Tag in einer Zelle eingesperrt, vom frühen Nachmittag bis zum späten Vormittag des nächsten Tages. Man hat keinen Anspruch mehr auf Sonne, Mond und Sterne. Das Gefängnis war nicht die Hölle, aber es gab dort keinen Himmel. Was auch ein schlimmer Zustand ist.
»Man kann es mit dem Zuhören auch übertreiben, weißt du.«
»Wie? Oh, tut mir leid. Ich war in Gedanken versunken«, sagte ich entschuldigend. »Übrigens, bevor ich’s vergesse, hier ist das Geld, das Ulla mir gegeben hat.«
Sie nahm das Bündel Scheine und steckte es in ihre Handtasche, ohne es anzusehen.
»Das Leben ist manchmal schon seltsam«, sagte sie. »Ulla hat sich mit Modena eingelassen, um von einem Mann loszukommen, der sie wie eine Sklavin behandelt hat. Und jetzt ist sie in gewisser Weise Modenas Sklavin. Aber sie liebt ihn, und deshalb schämt sie sich, dass sie ihn anlügen muss, wenn sie ein bisschen Geld für sich behalten will.«
»Manche Leute brauchen diese Machtspiele.«
»Nicht nur manche Leute«, erwiderte Karla. Ihre Stimme klang zornig und bitter. »Als du mit Didier über Freiheit geredet hast, als er wissen wollte, welche Art von Freiheit du meinst, hast du gesagt: die Freiheit, nein sagen zu können. Es mag komisch klingen, aber ich dachte immer, es sei viel wichtiger, dass man die Freiheit hat, ja sagen zu können.«
»A propos Didier«, sagte ich beiläufig, um sie aus ihrer düsteren Stimmung zu reißen, »ich habe heute lange mit ihm geredet, als ich auf dich gewartet habe.«
»Ich schätze mal, dass vor allem Didier geredet hat«, mutmaßte sie.
»Na ja, stimmt schon, aber es war interessant. Es hat mir Spaß gemacht. Es war das erste Mal, dass wir uns richtig unterhalten haben.«
»Was hat er dir erzählt?«
»Erzählt?« Ich fand die Frage seltsam; sie hörte sich an, als hätte Didier Geheimnisse, die er um keinen Preis verraten durfte. »Er hat über die Leute im Leopold’s geredet. Die Afghanen, die Iraner, die Shiv Sainiks oder wie sie heißen, und die Mafiabosse.«
Karla lächelte ironisch.
»Ich würde nicht viel darauf geben, was Didier so erzählt. Er kann ziemlich oberflächlich sein, vor allem, wenn er so ernsthaft tut. Der weiß nicht mal, wie sich das Wort ›Tiefgang‹ schreibt. Ich hab ihm das auch mal gesagt – dass es schon eine Kunst sei, so flach zu schürfen wie er. Das fand er dann auch noch gut. Eins muss man Didier jedenfalls zugutehalten: Man kann ihn wirklich kaum beleidigen.«
»Ich dachte, ihr wärt Freunde«, wandte ich ein und beschloss, ihr nicht zu erzählen, was Didier über sie gesagt hatte.
»Freunde … na ja … manchmal bin ich mir nicht sicher, was Freundschaft ist. Wir kennen uns seit Jahren. Wir haben mal zusammengewohnt – hat er dir das erzählt?«
»Nein.«
»Ein Jahr, gleich nach meiner Ankunft in Bombay. Wir haben in einer irren, halb verfallenen Bruchbude im Fort-Viertel gewohnt. Jeden Morgen sind wir mit Putz im Gesicht aufgewacht, der
Weitere Kostenlose Bücher