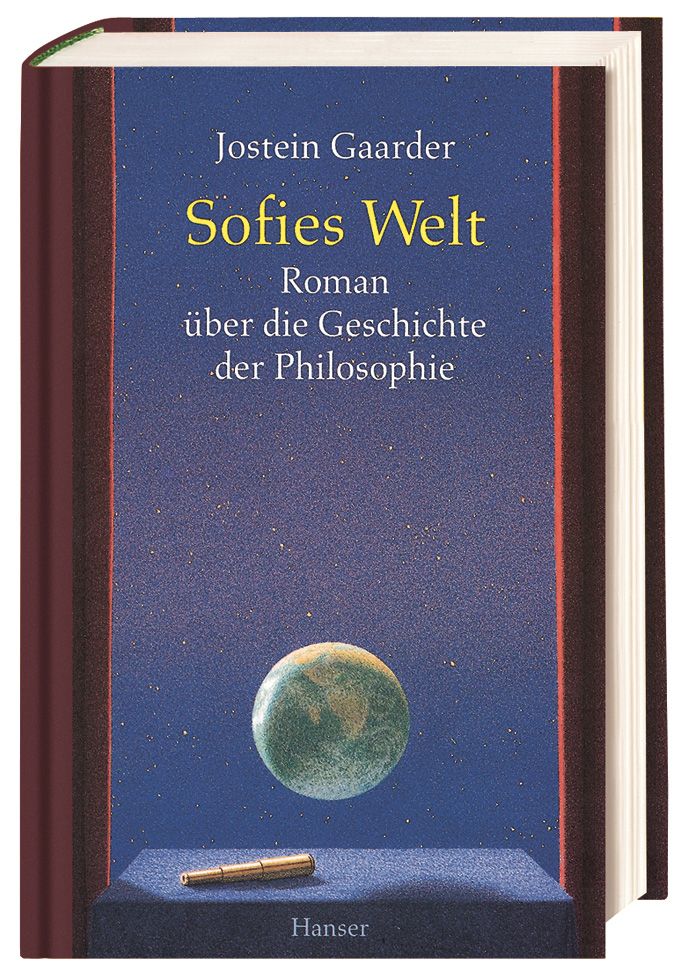![Sofies Welt - Roman über die Geschichte der Philosophie]()
Sofies Welt - Roman über die Geschichte der Philosophie
auf das mechanistische Weltbild der Aufklärungszeit. Zu Recht ist behauptet worden, dass die Romantik eine Renaissance des alten ganzheitlichen Denkens mit sich gebracht hat.«
»Erklär mir das!«
»Das bedeutet vor allem, dass die Natur wieder als Einheit betrachtet wurde. Die Romantiker griffen dabei auf Spinoza zurück, aber auch auf Plotin und Renaissancephilosophen wie Jakob Böhme und Giordano Bruno . Sie alle hatten in der Natur ein göttliches ›Ich‹ erlebt.«
»Sie waren Pantheisten ...«
» Descartes und Hume hatten eine scharfe Grenze zwischen dem Ich und der ›ausgedehnten‹ Wirklichkeit gezogen. Auch Kant hatte eine scharfe Trennung zwischen dem erkennenden Ich und der Natur ›an sich‹ gesetzt. Jetzt wurde die Natur als ein einziges großes ›Ich‹ bezeichnet. Die Romantiker verwendeten auch Ausdrücke wie ›Weltseele‹ oder ›Weltgeist‹.«
»Ich verstehe.«
»Ihr wichtigster Philosoph war Friedrich Wilhelm Schelling , der von 1775 bis 1854 lebte. Er versuchte, die Trennung von ›Geist‹ und ›Materie‹ aufzuheben. Die ganze Natur – sowohl die Seele des Menschen als auch die physische Wirklichkeit – sei Ausdruck des einen Gottes oder des ›Weltgeistes‹, meinte er.«
»Ja, das erinnert an Spinoza.«
»Die Natur sei der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur, meinte Schelling. Denn überall in der Natur ahnten wir einen ordnenden, strukturierenden Geist. Er hat die Materie als eine Art schlummernde Intelligenz angesehen.«
»Das musst du genauer erklären.«
»Schelling sah in der Natur einen Weltgeist, aber er sah diesen Weltgeist auch im Bewusstsein des Menschen. So gesehen, sind eigentlich die Natur und das menschliche Bewusstsein Ausdruck ein und desselben.«
»Ja, warum nicht?«
»Den Weltgeist kann man also sowohl in der Natur als auch im eigenen Gemüt suchen. Novalis konnte deshalb sagen, dass der ›geheimnisvolle Weg‹ nach innen gehe. Er meinte, dass der Mensch das gesamte Universum in sich trage und deshalb das Geheimnis der Welt am besten erleben könne, wenn er in sich geht.«
»Das ist ein schöner Gedanke.«
»Für viele Romantiker gingen Philosophie, Naturforschung und Dichtung in einer höheren Einheit auf. Ob man nun in der Studierkammer saß und inspirierte Gedichte schrieb, oder ob man das Leben der Blumen und die Zusammensetzung der Steine untersuchte – es waren nur zwei Seiten derselben Medaille, wenn die Natur kein toter Mechanismus war, sondern lebendiger Weltgeist.«
»Wenn du noch mehr erzählst, werde ich auf der Stelle zur Romantikerin.«
»Der norwegische Naturforscher Henrik Steffens – den Wergeland als ›Norwegens verwehtes Lorbeerblatt‹ bezeichnete, weil er nach Deutschland umgezogen war – kam 1801 nach Kopenhagen, um Vorlesungen über die deutsche Romantik zu halten. Er charakterisierte die romantische Bewegung mit den Worten: ›Müde der ewigen Versuche, uns durch die rohe Materie zu kämpfen, wählten wir einen anderen Weg und wollten dem Unendlichen entgegeneilen. Wir gingen in uns und schufen eine neue Welt.‹«
»Wie kannst du dir das alles auswendig merken?«
»Eine Kleinigkeit, Sofie.«
»Erzähl weiter!«
»Schelling sah ebenfalls in der Natur eine Entwicklung von den Steinen bis hin zum menschlichen Bewusstsein und verwies dabei auf schrittweise Übergänge von der leblosen Natur zu komplizierteren Lebensformen. Die romantische Natursicht war überhaupt von der Auffassung der Natur als eines Organismus geprägt, also einer Einheit, die durch die Zeiten die ihr innewohnenden Möglichkeiten entwickelt. Die Natur ist wie eine Blume, die ihre Blätter und Blüten entfaltet. Oder wie ein Dichter, der seine Gedichte entfaltet.«
»Erinnert das nicht ein bisschen an Aristoteles?«
»Doch, sicher. Die romantische Philosophie weist sowohl aristotelische als auch neoplatonische Züge auf. Aristoteles hatte ja eine organischere Auffassung der Naturprozesse als die mechanistischen Materialisten.«
»Ich verstehe.«
»Ähnliche Gedanken finden wir auch in einem neuen Geschichtsbild. Große Bedeutung für die Romantiker hatte der Geschichtsphilosoph Johann Gottfried Herder , der von 1744 bis 1803 lebte. Er hielt auch den Verlauf der Geschichte für das Resultat eines zielgerichteten Prozesses. Ebendarum bezeichnen wir sein Geschichtsbild als ›dynamisch‹. Die Aufklärungsphilosophen hatten oft ein ›statisches‹ Geschichtsbild. Für sie gab es nur eine universelle oder allgemein gültige Vernunft,
Weitere Kostenlose Bücher