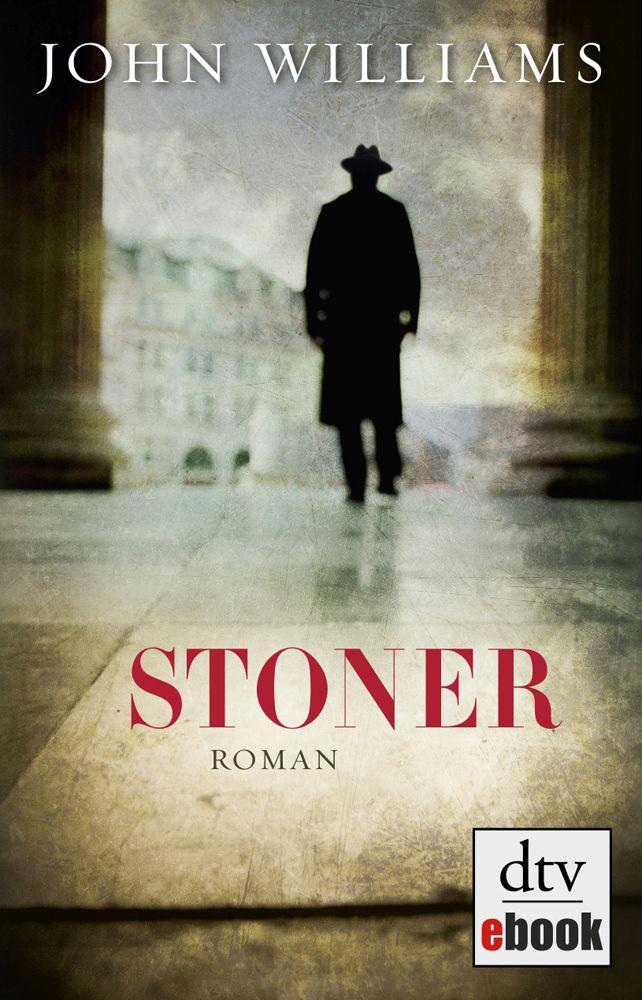![Stoner: Roman (German Edition)]()
Stoner: Roman (German Edition)
einem der geradlehnigen Stühle, die Füße gespreizt, ein wenig vorgebeugt, die Hände umfassten die Knie. Irgendwann sahen die Footes sich an, gähnten und verkündeten, es sei schon spät. Sie gingen in ihr Schlafzimmer, und die drei blieben allein zurück.
Wieder herrschte Schweigen. Seine Eltern, die vor sich in die von den eigenen Leibern geworfenen Schatten starrten, warfen gelegentlich einen Seitenblick auf ihren Sohn, so als wagten sie es angesichts seines neu erworbenen Bildungsstandes nicht, ihn zu stören.
Nach mehreren Minuten beugte sich William Stoner schließlich vor und sagte nachdrücklich und lauter als eigentlich beabsichtigt: »Ich hätte es euch früher sagen sollen. Letzten Sommer oder heute Morgen.«
Im Licht der Lampe wirkten die Mienen seiner Eltern dumpf und ausdruckslos.
»Was ich sagen will: Ich komme nicht mit euch zurück auf die Farm.«
Niemand regte sich. Sein Vater sagte: »Wenn du hier noch ein paar Dinge zu erledigen hast, können wir morgen vorfahren und du kommst in ein paar Tagen nach.«
Stoner rieb sich das Gesicht mit offener Hand. »So … habe ich das nicht gemeint. Ich versuche euch zu sagen, dass ich überhaupt nicht auf die Farm zurückkomme.«
Sein Vater umfasste seine Knie etwas fester und richtete sich auf. »Steckst du in Schwierigkeiten?«
Stoner lächelte. »Nein, nichts dergleichen. Ich werdenoch ein weiteres Jahr zur Universität gehen, vielleicht auch noch zwei, drei Jahre.«
Der Vater schüttelte den Kopf. »Ich habe doch heute Abend gesehen, wie du fertig geworden bist. Und der Viehhändler hat gesagt, die Landwirtschaftsschule dauert vier Jahre.«
Stoner versuchte, dem Vater seine Absichten zu erklären, versuchte, in ihm jenes Gefühl für Sinn und Bedeutsamkeit zu wecken, das er selbst empfand, doch hörte er seine Worte wie aus dem Mund eines Fremden dringen und sah dabei das Gesicht seines Vaters, auf das diese Worte einhieben wie der wiederholte Schlag einer Faust auf einen Stein. Als er verstummte, saß der Vater da, die Hände zwischen die Knie geklemmt, den Kopf gesenkt. Er lauschte der Stille im Zimmer.
Endlich regte er sich, und Stoner blickte auf, blickte in die Gesichter seiner Eltern und hätte sie am liebsten laut angefleht.
»Ich weiß nicht«, sagte sein Vater mit rauer, müder Stimme. »So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, dich hierherzuschicken sei das Beste, was ich für dich tun kann. Deine Ma und ich, wir wollten nämlich immer nur das Beste für dich.«
»Ich weiß«, sagte Stoner und konnte sie nicht länger anschauen. »Kommt ihr denn zurecht? Ich könnte im Sommer eine Weile aushelfen. Ich könnte …«
»Wenn du meinst, dass du hierbleiben und deine Bücher studieren musst, dann musst du das wohl. Deine Ma und ich, wir schaffen das schon.«
Seine Mutter hielt ihm das Gesicht zugewandt, sah ihn aber nicht an. Sie kniff die Augen zusammen, presste diegeballten Fäuste an die Wangen, atmete schwer, und ihre Miene war wie vor Schmerz verzerrt. Erstaunt begriff Stoner, dass sie weinte, stumm und aus tiefstem Innern, mit all der Scham und Verlegenheit eines Menschen, der selten weint. Er betrachtete sie einen Augenblick, dann erhob er sich schwerfällig, ging aus dem Wohnzimmer und erklomm die schmale Stiege, die in seine Dachkammer führte; er lag noch lange auf dem Bett und starrte mit offenen Augen in die Dunkelheit.
II
ZWEI WOCHEN, NACHDEM STONER das Studium abgeschlossen hatte, wurde in Sarajewo Erzherzog Franz Ferdinand von einem serbischen Nationalisten erschossen, und noch vor dem Herbst herrschte überall in Europa Krieg. Für die älteren Studenten war dies ein Thema von drängendem Interesse, da sie sich fragten, welche Rolle Amerika in diesem Krieg zufalle, sodass sie der eigenen Zukunft mit wohliger Verunsicherung entgegensahen.
Vor William Stoner aber lag die Zukunft klar, solide und unwandelbar. Für ihn war sie keine Abfolge von Ereignissen, Veränderungen und Möglichkeiten, sondern ein Territorium, das nur darauf wartete, erkundet zu werden. Sie war wie die große Universitätsbibliothek, der neue Flügel angebaut, neue Bücher einverleibt, die, auch wenn alte Werke entliehen werden mochten, im Kern doch unverändert blieb. Er sah seine Zukunft in dieser Institution, der er sich verschrieben hatte und die er nur so unvollkommen verstand, sah sich als jemanden, der sich in dieser Zukunft veränderte, nur war ihm die Zukunft selbst Instrument dieser Veränderung, nicht ihr Objekt.
Gegen Ende
Weitere Kostenlose Bücher