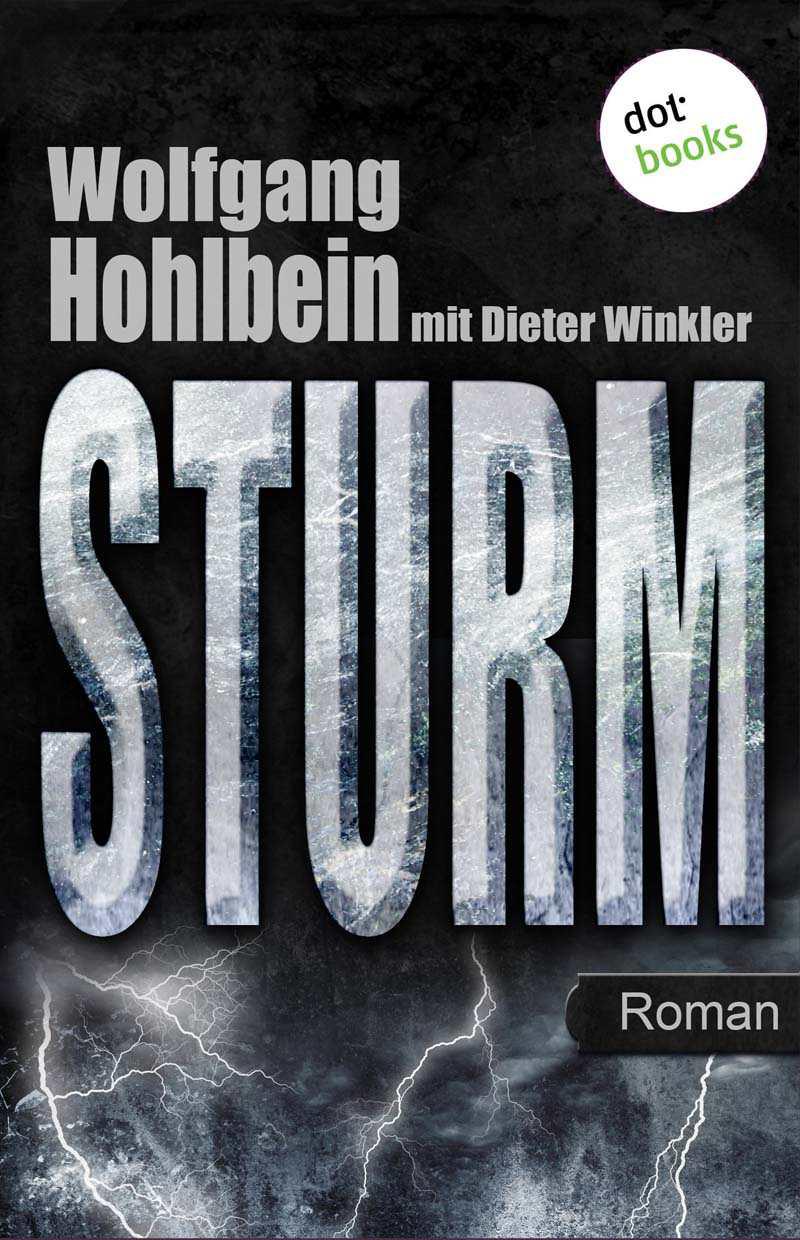![Sturm: Roman (German Edition)]()
Sturm: Roman (German Edition)
für Dirk.
Erst nach endlosen, quälenden Sekunden dämmerte es ihm. The tank … Der Panzer. Natürlich. Ventura hatte es doch noch geschafft, das Geschütz klarzumachen.
Auch das war ihm gleichgültig. Alles war egal. Er musste hinaus, zurück in den Gang, zu Noah.
Er hatte gesehen, dass sein Sohn zwei Mal getroffen worden war, aber das musste nicht bedeuten, dass er tot war. Wenn es ihm irgendwie gelang, Noah zu Lubaya zu bringen, hatte er vielleicht eine Überlebenschance.
Die beiden Männer traten zu ihm. Der eine, ein großer, grobschlächtiger Kerl, nahm ihm die Waffe ab. Dirk ließ es widerstandslos geschehen. Der andere bog ihm die Hände auf den Rücken und legte ihm Handschellen an. Dirk wusste, dass er sich hätte wehren müssen, dass er alles hätte tun müssen, um Noah zu retten. Aber er war wie gelähmt.
Erst, als die beiden ihn vorwärtsschoben, regte sich Widerstand in ihm.
»My son«, murmelte er. »I have to go to him.«
Die Männer reagierten, indem sie ihn in den Rücken stießen. Nun wollte sich Dirk doch wehren, aber mit gefesselten Händen war er vollkommen hilflos. Sein Versuch, sich umzudrehen, wurde mit weiteren, harten Stößen quittiert.
In einer Ecke unweit der beiden Hubschrauber, halb hinter einem rot markierten Pfeiler verborgen, der wahrscheinlich den Piloten als Orientierung dienen sollte, hockte eine Gestalt auf dem Boden. Auch sie schien gefesselt zu sein und verschmolz fast mit den Schatten.
Dirk achtete nicht weiter auf sie. Seine Gedanken kreisten um Noah. Wenn sich Kinah sofort um ihn gekümmert und seine Blutung gestoppt hatte … Er wusste, dass dies eine zweifelhafte Hoffnung war, denn schließlich hatten Kinah und Noah unter heftigem Beschuss gelegen. Möglicherweise war Kinah bereits tot, durchsiebt von den Kugeln der Männer, die aus der Halle heraus auf sie zugestürmt waren.
Einer seiner beiden Bewacher trat ihm in die Kniekehlen, und Dirk knickte ein und wäre gegen die Wand geknallt, wenn der andere Mann ihn nicht an der Schulter gepackt und gleichzeitig nach unten gedrückt hätte. Dabei murmelte er irgendetwas Unverständliches, bei dem es sich eigentlich nur um einen knappen Befehl in englischer Sprache handeln konnte.
Schließlich hockte Dirk am Boden. Den feurigen Schmerz in seinem Oberschenkel nahm er kaum wahr. Sein Atem ging flach. Dunkle Wolken drohten, sich über sein Bewusstsein zu schieben. Nur ganz am Rande bekam er mit, dass die beiden Männer kurz und hektisch miteinander redeten und dann im Laufschritt in die Richtung verschwanden, aus der sie gekommen waren.
»Papa?«
Dirk schloss die Lider und keuchte. Seine Gedanken begannen sich immer mehr zu verwirren. Plötzlich sah er Akuyi vor seinem inneren Auge. Sie blickte ihn ernst an und versuchte, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
»PAPA!!!«
Dirk schlug die Augen auf. Das war keine Wahnvorstellung … Die Stimme war direkt neben ihm!
Langsam drehte er den Kopf. Lange schwarze Haare, ein schmales, hübsches Mädchengesicht, angstrunde Augen …
Dirk erbebte. Die dunklen Wolken verzogen sich schlagartig. »Akuyi!«, krächzte er.
»Papa!« Akuyis Stimme klang verzweifelt. »Was ist passiert? Wo kommst du her?«
Dirk schwieg. Ein Wasserfall von Worten wollte über seine Lippen drängen, doch er brachte keinen einzigen Ton heraus. Akuyi. Wie sehr hatte er sich gewünscht, sie zu finden. Das Schicksal war wirklich grausam. Noah von zwei Kugeln getroffen, Kinah gefangen, verletzt oder erschossen, er selbst gefesselt und zerschlagen, am Ende seiner Kraft und seiner Möglichkeiten.
»Was ist passiert?«, fragte Akuyi noch einmal. Ein leicht hysterischer Unterton schwang in ihrer Stimme mit.
»Es ist …« Alles in Ordnung? War es wirklich das, was er ihr sagen wollte?
»Wo ist Mama?«
»Sie ist … ganz in der Nähe.« Dirk richtete sich so weit auf, wie es ihm möglich war. »Wir haben dich gesucht.«
»Und jetzt haben sie dich auch geschnappt«, flüsterte Akuyi. »Das tut mir leid.«
Ja, Dirk tat es auch leid. Er hatte alles vermasselt. Anstatt seine Tochter zu retten, hatte er sogar noch zugelassen, dass sein Sohn zusammengeschossen wurde – und saß nun als Gefangener hier.
»Wie … wie geht es dir?«, fragte Akuyi.
Wie es ihm ging?
Dirk holte tief Luft. Es wäre keine gute Idee, seiner Tochter zu erzählen, wie es ihm wirklich ging.
»Mir geht es gut«, sagte er rau. Aber deinem Bruder nicht. »Hast du eine Ahnung, was die von uns wollen?«
»Ich weiß nicht«,
Weitere Kostenlose Bücher