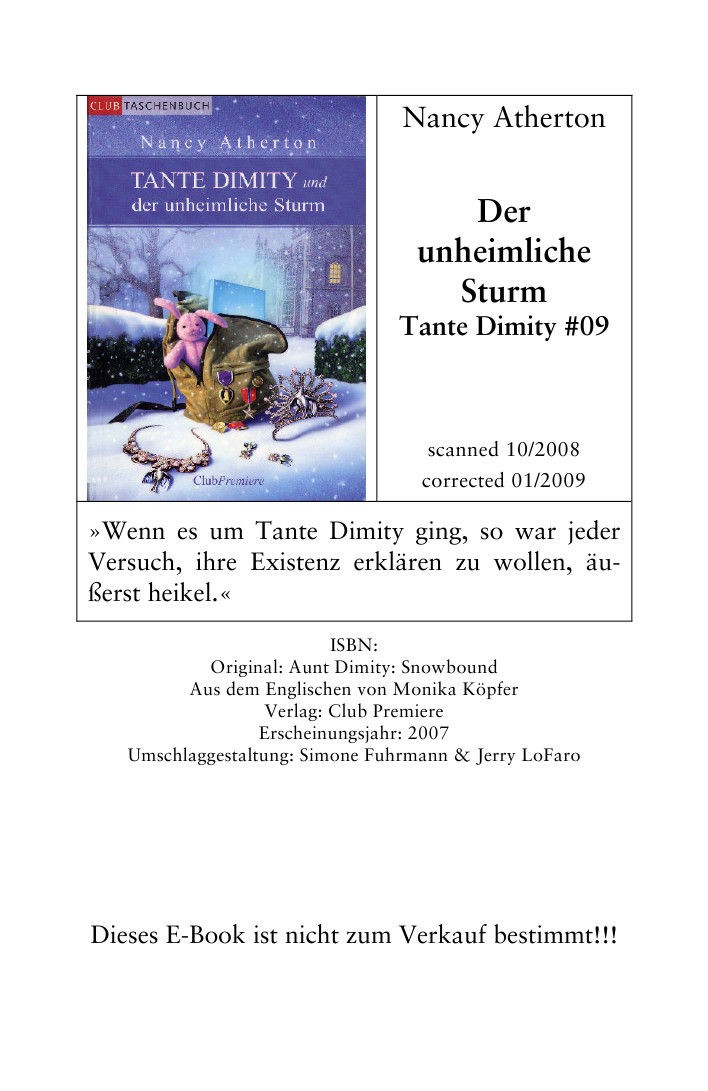![Tante Dimity und der unheimliche Sturm]()
Tante Dimity und der unheimliche Sturm
Federhalter auf den Schreibtisch zurück. »Ich hatte nie Gelegenheit, es herauszufinden.«
Wendy runzelte erstaunt die Stirn.
Ich hielt ihrem Blick stand. »Mein Vater starb, als ich drei Monate alt war. Also konnte ich ihm nie böse sein. Oder ihm vergeben.« Ich seufzte.
»Noch ein Grund, Sie zu beneiden.«
Wendys Mund wurde wieder schmal, und sie wandte den Blick ab. Einen Moment lang glaubte ich, dass ich zu weit gegangen war, dass sie mir gleich sagen würde, ich solle mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern, oder dass sie hinausgehen würde, um nie mehr mit mir zu sprechen. Stattdessen ließ sie die Schultern hängen und sagte schroff: »Warum hat Tessa Gibbs dieses Zimmer nicht restauriert? Es ist makaber, es zu lassen, wie es ist.«
Ich war dankbar für den Themenwechsel und heilfroh, dass ich so leicht davongekommen war.
»Vielleicht hat sie einfach noch keine Zeit gehabt, sich darum zu kümmern«, sagte ich. »Oder vielleicht dient es auch als Anschauungsobjekt, sozusagen als Beweis dafür, wie heruntergekommen die Abtei war, ehe sie sie restaurierte. Das Zimmer ist jedenfalls ein wesentlicher Teil von Ladythornes Geschichte.« Mit der Fingerspitze zeichnete ich einen Kreis in den Staub auf dem Schreibtisch und dachte: Die Verrückte in der Dachkammer.
Arme Lucasta. Was für ein Vermächtnis.
»Sollen wir zusammen weitersuchen?«, fragte Wendy, die es noch immer vermied, mich anzusehen.
»Sicher.« Ich tat so, als wäre ich damit beschäftigt, mir den Staub vom Finger zu wischen, so erstaunt war ich über ihr Angebot. Kameradschaft war das Letzte, was ich als Antwort auf mein Eindringen in ihre Gefühlswelt erwartet hätte. »Ich übernehme das Ankleidezimmer.«
»Dann fange ich hier an.« Wendy ging zum Nachttisch, während sie hinzufügte: »Gleichzeitig werde ich auf Catchpoles Schneepflug lauschen. Wenn der Motor ausgeht, können wir schnell zurück auf unsere Zimmer huschen.«
»Einverstanden«, sagte ich und ging in den angrenzenden Raum.
Ziemlich benommen betrat ich das Ankleidezimmer, darauf gefasst, eine Art von Miss-Havisham-Szenerie anzutreffen, mit allem, was dazugehört: ein mit Spinnweben überzogenes Brautkleid und ein vertrockneter Brautstrauß.
Doch zu meiner großen Überraschung fanden sich in diesem Raum keinerlei Anklänge an Dickens’ Roman, vielmehr war er nur spärlich möbliert, tadellos sauber und die Luft geschwängert mit dem Geruch von Mottenkugeln. Die Twinsets und Tweedröcke im Schrank waren alt, aber keineswegs zerschlissen, und die bequemen Schuhe, die sich auf dem Boden reihten, hatten zwar leicht abgetretene Absätze, waren aber ordentlich besohlt und geputzt. Gute Kleidungsstü cke, habe ich mir sagen lassen, sind dazu geschaffen, sie lange zu tragen, und diese waren von der Sorte.
Die einzigen Sachen, die ein wenig abgetragen wirkten, waren zwei Nachthemden und eine unförmige Strickweste mit Zopfmuster, die gewiss zum Einsatz gekommen war, als der Kohlenvorrat zur Neige ging. Ich befühlte die raue Wolle eines Ärmels, und wieder überkam mich ein Anflug von Mitleid für die einst vor Lebenslust sprühende Frau, die sich so hübsch für ihre verwundeten Offiziere angezogen hatte.
Eine Bürste mit Elfenbeinbesatz und ein Handspiegel lagen auf der Frisierkommode griffbereit neben einer Porzellandose, die mit Haarnadeln gefüllt war. Die grauen Haare, welche die Bürste durchzogen, beschworen das Bild einer alten Frau herauf, die das Haar zu einem Knoten gebunden trug, die Hände über der Teekanne wärmte, während sie darüber nachdachte, welches Familienerbstück sie als Nächstes veräußern sollte, um die steigenden Lebenshaltungskosten – und das Porto für ihre Überseepost – zu begleichen.
In der linken Schublade der Frisierkommode fand ich ein kunstvoll besticktes Etui für Taschentücher. Als ich den Satinumschlag mit den spitzenbesetzten Ecken aufschlug, spürte ich etwas Hartes, das unter dem Stoff verborgen war. Ich fuhr mit der Hand in das Etui und zog ein Buch heraus. Es war in Maroquinleder gebunden und hatte einen Goldschnitt. Weder die Vorderseite noch der Buchrücken waren beschriftet.
Ich wagte kaum zu atmen, als ich die erste Seite umblätterte. Dort standen, in einer regelmäßigen, runden Handschrift, die Worte LUCASTA DECLERKE, TAGEBUCH. Der erste Eintrag
war auf den 1. Januar 1945 datiert.
»Großer Gott«, flüsterte ich und ließ mich auf den Hocker sinken. »Wendy!«, rief ich. »Kommen Sie her.«
Sogleich kam
Weitere Kostenlose Bücher