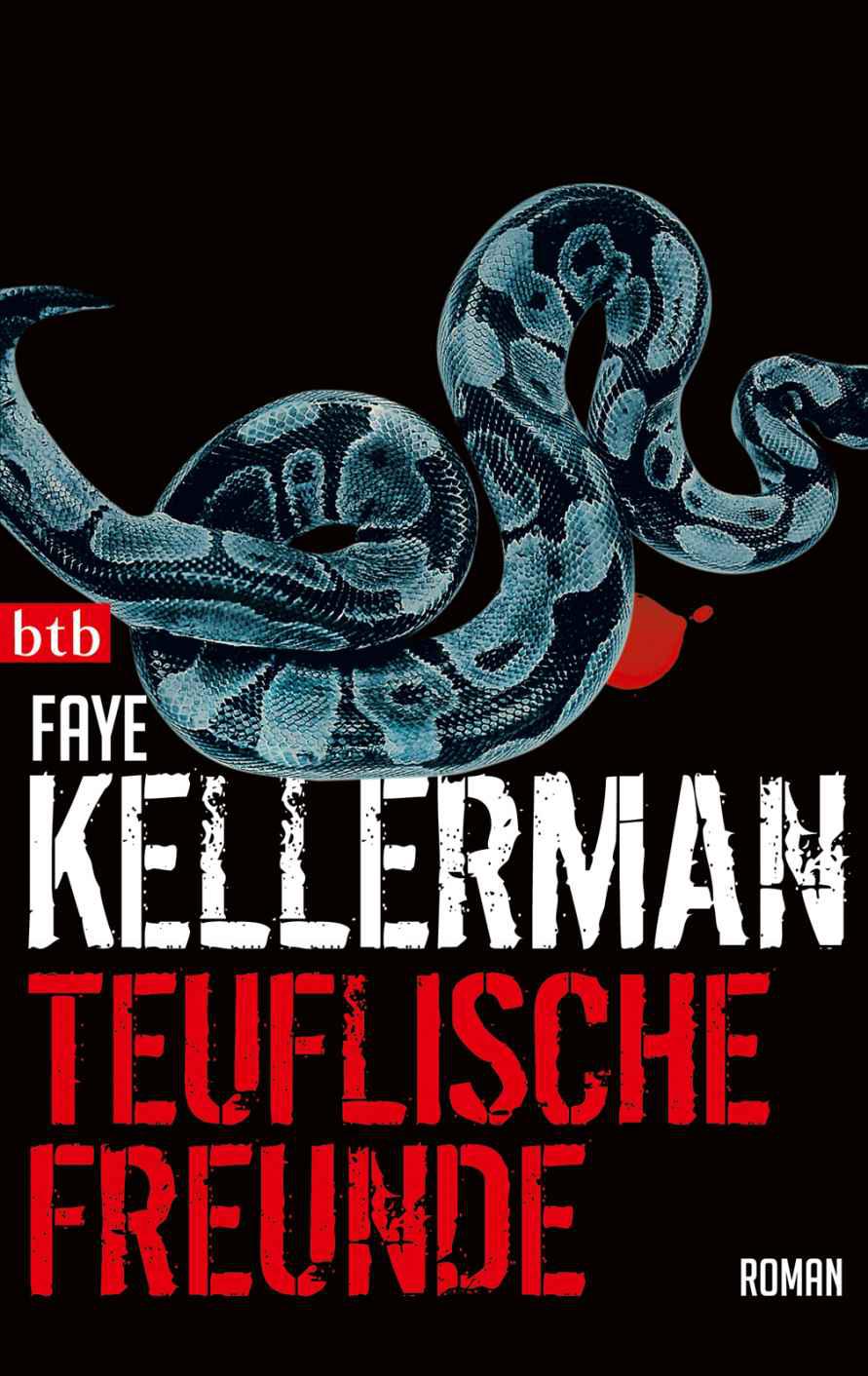![Teuflische Freunde: Roman (German Edition)]()
Teuflische Freunde: Roman (German Edition)
nicht lebensmüde, er war nicht launisch, er nahm keine Drogen, er trank keinen Alkohol, er war kein Einzelgänger, er hatte Freunde, und er hatte noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Ich weiß nicht mal, wie die Waffe überhaupt in seine Hände gelangt sein könnte!« Sie brach schluchzend zusammen.
Decker ließ sie sich ausweinen und reichte ihr nur eine Schachtel Kleenex.
»Was erwarten Sie von uns, Mrs. Hesse?«
»Wen…dy.« Sie antwortete zwischen zwei Schluchzern. »Finden Sie heraus, was passiert ist.« Sie sah sie flehentlich an. »Ich weiß, das gehört wahrscheinlich nicht zur Aufgabe der Polizei, aber ich weiß nicht, bei wem ich sonst Hilfe suchen soll.«
Stille.
»Und wenn ich einen Privatdetektiv engagiere? Vielleicht kann er ja wenigstens ermitteln, woher Gregory die Waffe hatte.«
»Wo ist die Waffe jetzt?«, fragte Decker.
»Die Polizei hat sie mitgenommen«, sagte Wendy.
»Dann sollte sie in der Asservatenkammer sein«, meinte Marge. »Sie steht auch in den Akten.«
»Dann holen wir sie uns und finden heraus, woher sie stammt.« Er widmete sich wieder Wendy. »Lassen Sie mich mit der Waffe beginnen, und von da aus machen wir weiter.«
»Danke!« Eine neue Runde Tränen kullerte aus Wendys Augen. »Danke, dass Sie mir glauben … oder wenigstens über das nachdenken, was ich Ihnen erzähle.«
»Dafür sind wir da.«
Decker pflichtete ihr mit einem Nicken bei. Die Frau befand sich vermutlich gerade in einer Phase massiven Nichtwahrhabenwollens. Aber manchmal, sogar in Situationen wie diesen, kannten Eltern ihre Kinder wirklich besser als jeder andere sonst.
3
Decker saß auf dem Sofa im Wohnzimmer, öffnete eine Dose Dad’s Root Beer und aalte sich in der wärmenden Anwesenheit seiner Frau und der Erinnerung an den Geschmack von Sülze. »Danke fürs Holen meines Abendessens.«
»Hätten wir gewusst, dass du so früh nach Hause kommst, hätten wir im Deli auf dich gewartet.«
»Passt wunderbar.« Er nahm Rinas Hand. Vor dem Essen hatte er erst mal geduscht und seinen Anzug gegen Sweatshirt und Jogginghose getauscht. »Wo ist der Junge?«
»Üben.«
»Wie läuft’s bei ihm?«
»Scheint alles in Ordnung zu sein. Wusstest du, dass Terry ihn kontaktiert hat?«
»Nein, aber das war ja praktisch vorprogrammiert. Wann denn?«
»Vor ungefähr einer Woche.« Rina fasste ihre Unterhaltung mit Gabe kurz zusammen. »Es hat ihn offensichtlich durcheinandergebracht. Beim Abendessen heute stand er richtig neben sich. Immer wenn er sich unwohl fühlt, redet er über seine anstehenden Vorspielwettbewerbe. Paradoxerweise scheinen ihn die Wettbewerbe zu beruhigen. Die Miete für den Flügel ist jedenfalls viel billiger als eine Therapie.«
Der Stutzflügel stand in der Garage – der einzige Ort, der genug Platz bot. Gabe teilte sich seinen Übungsraum mit Deckers Porsche, Werkbank und Gerätschaften und Rinas Garten- und Pflanztisch. Sie hatten den Raum schalldicht dämmen lassen, weil der Junge zu den merkwürdigsten Zeiten übte. Aber seit er zu Hause unterrichtet wurde und praktisch mit der Highschool fertig war, ließen sie ihn in seinem eigenen Rhythmus schalten und walten. Mit nicht mal sechzehn war er bereits am Juilliard College angenommen und hatte es auf die Liste der frühen Zulassungen in Harvard geschafft. Selbst wenn die Deckers seine gesetzlichen Vormünder wären, hätten sie wahrhaftig keinerlei Bedarf mehr an Orientierungshilfe ihrerseits gesehen. Ab jetzt versorgten sie ihn nur noch mit Essen, einem sicheren Dach über dem Kopf und ein bisschen Gesellschaft.
»Erzähl mir von deinem Tag«, sagte Rina.
»Das Übliche, bis auf die letzte halbe Stunde.« Decker berichtete Rina von seinem verwirrenden Gespräch mit Wendy Hesse.
»Die arme Frau.«
»Sie muss wirklich sehr leiden, wenn ihr ein Mord lieber wäre als ein Selbstmord.«
»Lautet so der Beschluss der Gerichtsmedizin? Selbstmord?«
Decker nickte.
»Also dann … sie will es nicht wahrhaben.«
»Stimmt. Normalerweise gibt es verdächtige Anzeichen, aber die Eltern schauen weg. Ehrlicherweise bin ich davon überzeugt, dass Wendy wie vor den Kopf geschlagen ist.« Er strich seinen Bart glatt. »Weißt du noch, als wir uns gerade kennengelernt hatten und du darauf bestanden hast, die Jungs auf die jüdische Ganztagsschule zu schicken, da hielt ich dich für total bescheuert. Angesichts dieser Schulgebühren hätten wir sie auch zur Lawrence oder eben zur Bell and Wakefield schicken können, und nicht auf eine
Weitere Kostenlose Bücher