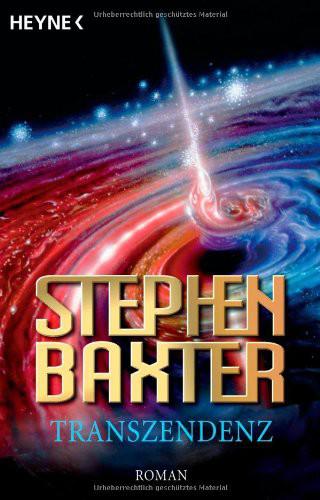![Transzendenz]()
Transzendenz
»Also bloß ein weiteres Schauermärchen?«
»Wir leben in einer Zeit der Furcht und des Staunens.«
»Ein Zeitalter der Vernunft ist es jedenfalls nicht.« John seufzte, während die Farbe sich weiterhin bei ihm dafür bedankte, dass er sie auftrug. »Hör dir dieses verdammte Zeug an. Lethe, vielleicht ist es vernünftig, unvernünftig zu sein.«
Fasziniert fragte ich: »Wie denken denn deine Kinder über dieses Millennium?«
»Gar nicht, soweit ich weiß. Ich versuche sie dazu zu bringen, sich die Nachrichten anzusehen, aber da stehe ich auf verlorenem Posten. Andererseits schaut sich heute sowieso niemand mehr die Nachrichten an, stimmt’s, Michael?«
»Wenn du es sagst«, blaffte ich zurück.
Diese Unterhaltung – angespannt, am Rand eines Wortgefechts – war typisch für uns. Sie war die dünne Deckschicht über einem Antagonismus, der bis in unsere späten Jugendjahre zurückreichte, als wir die Welt allmählich zur Kenntnis genommen und unsere Haltungen zur Zukunft entwickelt hatten.
Mein Ziel war es gewesen, Ingenieur zu werden; ich wollte Dinge bauen. Und ich war fasziniert vom Weltraum. Schließlich hatte man die Kuiper-Anomalie entdeckt, als ich zehn gewesen war: ein wahrhaftiges außerirdisches Artefakt am Rand des Sonnensystems. Wer von uns sich für solche Dinge interessierte, dessen gesamte Perspektive im Universum hatte sich verändert. Aber wir waren in der Minderheit, die Welt drehte sich weiter, und ich verlor den Anschluss.
John hingegen wurde Anwalt und spezialisierte sich auf Entschädigungsklagen für Umweltschäden. Ich fand ihn zynisch, aber im Kielwasser der ungeheuren politischen und ökonomischen Umwälzungen im Gefolge des Patronats-Programms war er zweifelsohne erfolgreich. Er zapfte die gewaltigen Geldströme an, die in einer destabilisierten Welt hin und her schwappten, war dadurch ungeheuer reich geworden und hegte nun größere Ambitionen – während ich, ein Ingenieur, der Dinge baute, kaum meine Rechnungen bezahlen konnte. Das sagt Ihnen wahrscheinlich alles, was Sie über den Zustand der Welt in jener Zeit wissen müssen.
Für Brüder kamen wir wirklich erstaunlich schlecht miteinander klar. Oder vielleicht auch nicht. Aber trotzdem, er war mein Bruder, der einzige noch übrige Mensch, der mich mein Leben lang kannte und halbwegs bei Verstand war, mit allem gebührenden Respekt für meine Mutter.
Und ich sehnte mich danach, ihm von Morag am Strand zu erzählen.
Ich hatte noch nie jemandem davon erzählt. Nun hatte ich das Gefühl, dass ich es tun sollte. Und wem sollte ich es erzählen, wenn nicht meinem Bruder? Wer sonst sollte davon erfahren? Er würde sich natürlich darüber lustig machen, aber das gehörte bei ihm nun mal dazu. Während ich dort stand und gemeinsam mit ihm arbeitete, während die Lichter in der zunehmenden Dunkelheit heller wurden, nahm ich meinen Mut zusammen und öffnete den Mund.
Dann erloschen die Lichter zischend zu einem silbergrauen Nichts. Auf einmal war John eine Silhouette vor einem dunkler werdenden Himmel, mit einem nutzlosen Pinsel in der Hand. Wir hörten das enttäuschte Geschrei der Kinder im Haus.
»Verdammt«, fauchte John.
Das Haus, oder jedenfalls die Farbe, entschuldigte sich. Verzeihung. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.
Es war ein kooperativer partieller Stromausfall; die in den Nachbarhäusern, den Bars, Läden und Straßenlaternen, in den Wasserpumpen, Bussen und Booten verstreuten KIs reagierten auf Alarmsymptome aus dem lokalen Strom-Mikronetz – für gewöhnlich eine Spannungsspitze in der Netzfrequenz – und schalteten sich ab. Es sei besser so, besser als in der schlechten alten Zeit dummer Systeme und massiver totaler Stromausfälle, sagten alle. Aber es ging einem trotzdem mörderisch auf den Wecker.
Meine Mutter steckte den Kopf aus dem Fenster. »Noch so ein Grund, weshalb ich das Silberzeug nicht leiden kann.«
John lachte. »Wir müssen das morgen früh fertig machen, Ma. Tut mir Leid.«
»Kommt lieber rein. Jetzt, wo die elektrischen Fliegengitter abgeschaltet sind, werden die Moskitos jeden Moment über euch herfallen. Ich habe Hirnloshähnchenschnitzel, Kekse und Spielkarten, um die Kinder bei Laune zu halten.« Sie schloss das Fenster mit einem Knall.
Ich warf John einen Blick zu. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, erspähte jedoch seine weißen Zähne. »Gin Rommee«, sagte er. »Ich hab das verdammte Gin Rommee immer gehasst.«
»Ich auch.« Wenigstens eines, das wir gemeinsam
Weitere Kostenlose Bücher