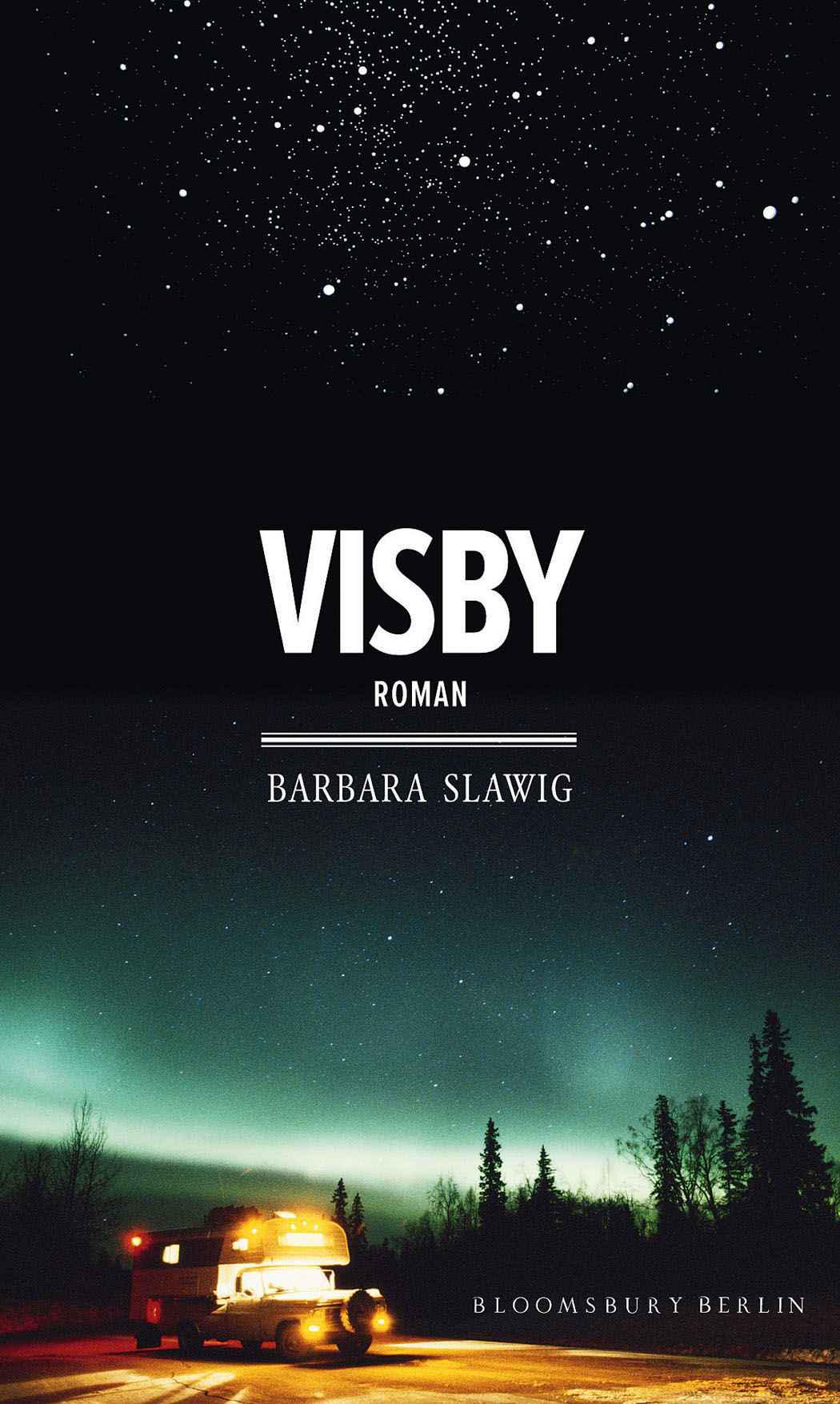![Visby: Roman (German Edition)]()
Visby: Roman (German Edition)
Dhanavatis Vater. Wenn er verheiratet gewesen wäre, hätte er ihnen das Kind abnehmen können. Was für eine Enttäuschung es gewesen sein muss, dass ich nie wiederkam.
Aber wir redeten nicht darüber, und ich schob die Erinnerung an die Reinerts beiseite. Es war so schön mit Adrian. Wir verstanden uns so gut. Wir sahen uns regelmäßig, mal in Kassel, meist in Berlin. Bald lebte ich nur noch für diese Treffen. Ich war unglücklich in Berlin. Ich interessierte mich nicht für Germanistik, ich fürchtete mich davor, in ein paar Jahren halberwachsene Großstadtkinder unterrichten zu müssen – aber unsere Liebe bewies, dass es trotzdem richtig gewesen war, von zu Hause wegzugehen, auf die mahnende Stimme zu hören, die mir gesagt hatte, ich müsste aus Husum hinaus in die große weite Welt. Für mich war Adrian die große Welt. Das eine Stück dieser Welt, mit dem ich zurechtkam.
Ein Jahr später, am letzten Wochenende im April 1985, bat er mich plötzlich, noch einmal mit ihm zu den Reinerts zu fahren. Ich glaube, ich stimmte nur deshalb zu, weil ich nicht zugeben wollte, dass ich vor einer Siebenjährigen Angst hatte. Ich verschob sogar meine Rückkehr nach Berlin um einen Tag, weil Adrian unter der Woche fahren wollte. Das sei einfach günstiger, sagte er.
Das Wetter war schön, in den Gärten blühten die Obstbäume. Adrian legte Musik von den Doors auf. Ich versuchte nicht daran zu denken, dass am Ende unserer Fahrt eine Teufelin wartete. Irgendwann unterwegs erwähnte Adrian, dass Dhanavatis Großmutter ein Herzleiden hatte und sich nicht mehr um ein kleines Kind kümmern konnte, so dass Dhanavati jetzt bei ihrem Onkel wohnte. Giselas Bruder. In Marsberg, der benachbarten Kleinstadt. Und als wir in Marsberg aus dem Auto stiegen, sagte er wie beiläufig, dass er schon zweimal am Wochenende dort gewesen war, aber nie jemanden angetroffen hatte. Deshalb waren wir an einem Montag gekommen: weil der Onkel dann in seiner Arztpraxis arbeiten würde.
Da begriff ich zum ersten Mal, welche Bedeutung die Nachmittage mit Dhanavati für ihn hatten. Wie viel Unausgesprochenes daran hing. Sonst habe ich nichts von diesem Ort im Gedächtnis behalten, aber an den Moment erinnere ich mich: vor uns die geschlossene Bahnschranke, neben uns eine lange Kolonne wartender Autos, jenseits der Bahnstrecke graue, hässliche Nachkriegshäuser, dahinter düstere Berghänge. Und neben mir Adrian, in Jackett und Krawatte, die langen schwarzen Locken stumpfgewaschen und zu glattgekämmt. Vor der Abfahrt, als er sich anzog, hatte ich mich noch darüber lustig gemacht: »Die Kleine fängt an zu schreien, wenn sie dich sieht.« Jetzt war ich es, die ihn ansah, als sei er ein Fremder.
Dann die Arztpraxis: Grünpflanzen, makelloser Teppichboden, eine etwas zu dicke, etwas zu stark geschminkte Arzthelferin hinter dem Tresen. Und der Arzt, Doktor Reinerts, Dhanavatis Onkel: weiße Jacke, weiße Hose, ein Gesicht, das man sofort wieder vergisst. Er musterte Adrian von oben bis unten, warf einen Blick auf meine Haare – lang, kraus, störrisch wie Drahtwolle und in jenem Jahr außerdem hennarot – und sagte genau einen Satz: »Wir wollen unsere Nichte von allem fernhalten, das sie an ihre unglückselige Vergangenheit erinnert.«
Das war alles. Adrian ging. Ich folgte ihm, und wir kehrten nach Kassel zurück. Unterwegs fragte ich ihn, ob Dhanavati seine Tochter war. Er verneinte. Ich glaubte ihm.
Am nächsten Morgen fuhr ich nach Berlin. Am Wochenende hätte Adrian zu mir kommen sollen, aber er sagte ab: Er sei erkältet. Am Sonntag rief ich ihn an und fragte ihn, wie er sich fühlte. Besser, sagte er, nur etwas zerschlagen. So klang er auch, also redeten wir nicht lange.
Am Mittwoch bekam ich seinen Brief. Liebste Annika, ich gehe weg … In seiner krakeligen Handschrift, in seinem immer noch fehlerhaften Deutsch. Ohne Erklärung, ohne etwas zu versprechen. Ich rief an: Es meldete sich niemand. Ich fuhr zum Bahnhof und stieg in den nächsten Zug nach Kassel. Lief zu Adrians Wohnhaus und klingelte. Es öffnete niemand. Ich überquerte die Straße und schaute vom anderen Bürgersteig zu seinen Fenstern hinauf. Sie waren geschlossen. Nirgendwo bewegte sich etwas.
Aber ich wollte es nicht glauben. Ich sagte mir, dass Adrian vermutlich einfach in der Abendschule war oder mit Freunden in der Kneipe. Ich müsste nur warten. Eine halbe Stunde lang stand ich auf der Straße. Dann ging ich um das Karree von Mietshäusern, sicherlich acht oder zehn
Weitere Kostenlose Bücher