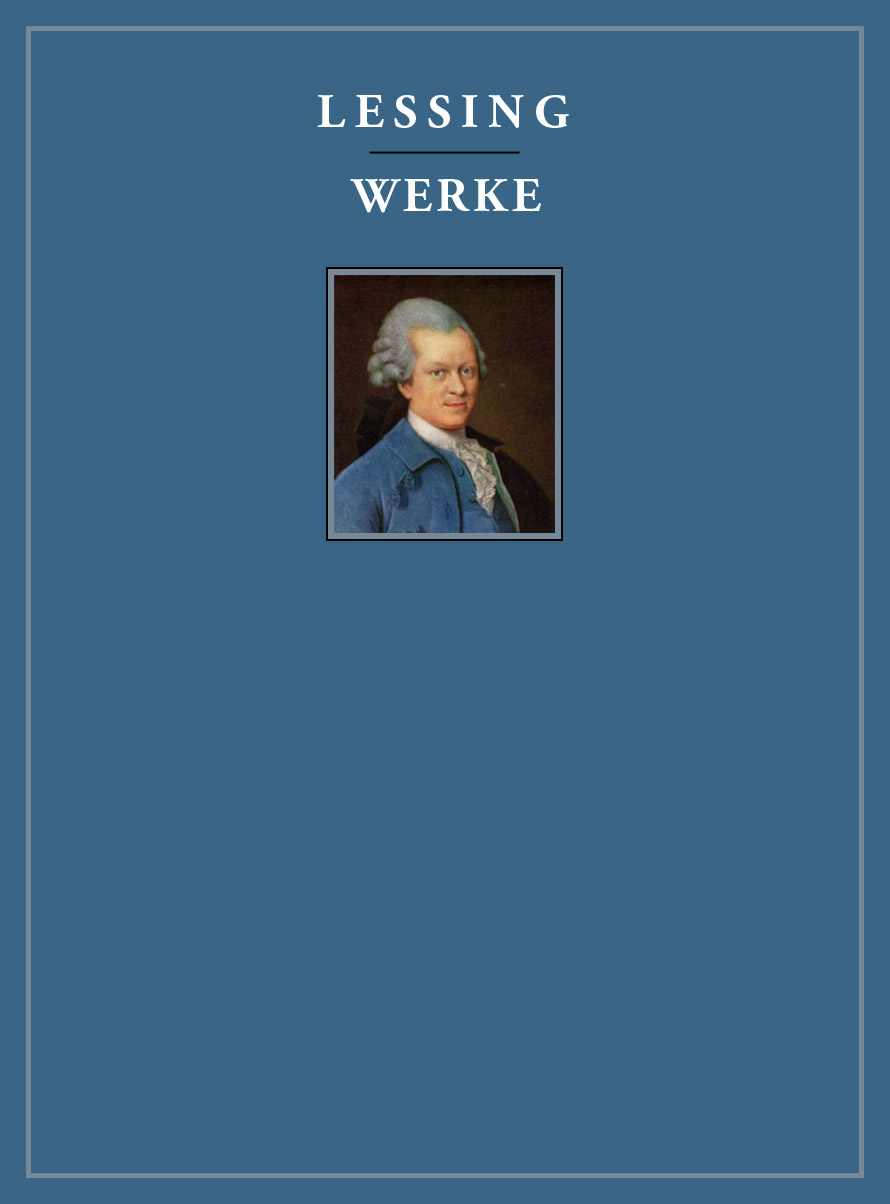![Werke]()
Werke
bist?
Lycast
. Ehrfurcht? Liebe? hm! die wird er wohl nicht von mir verlangen.
Leander
. Er sollte sie nicht verlangen?
Lycast
. Nein, gewiß nicht. Ich habe meinen Vater gar nicht lieb. Ich müßte es lügen, wenn ich es sagen wollte.
Leander
. Unmenschlicher Sohn! Du bedenkst nicht, was du sagst. Denjenigen nicht lieben, der dir das Leben gegeben hat! So sprichst du itzt, da du ihn noch leben siehst. Aber verliere ihn einmal; hernach will ich dich fragen.
Lycast
. Hm! Ich weiß nun eben nicht, was da geschehen würde. Auf allen Fall würde ich wohl auch so gar unrecht nicht tun. Denn ich glaube, er würde es auch nicht besser machen. Er spricht ja fast täglich zu mir: »Wenn ich dich nur los wäre! wenn du nur weg wärest!« Heißt das Liebe? Kannst du verlangen, daß ich ihn wieder lieben soll?
Auch die strengste Zucht müßte ein Kind zu so unnatürlichen Gesinnungen nicht verleiten. Das Herz, das ihrer, aus irgend einer Ursache, fähig ist, verdienet nicht anders als sklavisch gehalten zu werden. Wenn wir uns des ausschweifenden Sohnes gegen den strengen Vater annehmen sollen: so müssen jenes Ausschweifungen kein grundböses Herz verraten; es müssen nichts als Ausschweifungen des Temperaments, jugendliche Unbedachtsamkeiten, Torheiten des Kitzels und Mutwillens sein. Nach diesem Grundsatze haben Menander und Terenz ihren Ktesipho geschildert. So streng ihn sein Vater hält, so entfährt ihm doch nie das geringste böse Wort gegen denselben. Das einzige, was man so nennen könnte, macht er auf die vortrefflichste Weise wieder gut. Er möchte seiner Liebe gern wenigstens ein Paar Tage, ruhig genießen; er freuet sich, daß der Vater wieder hinaus auf das Land an seine Arbeit ist; und wünscht, daß er sich damit so abmatten, – so abmatten möge, daß er ganze drei Tage nicht aus dem Bette könne. Ein rascher Wunsch! aber man sehe, mit welchem Zusatze:
– – – utinam quidem
Quod cum salute ejus fiat, ita se defatigarit velim,
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.
Quod cum salute ejus fiat! Nur müßte es ihm weiter nicht schaden! – So recht! so recht, liebenswürdiger Jüngling! Immer geh, wohin dich Freude und Liebe rufen! Für dich drücken wir gern ein Auge zu! Das Böse, das du begehst, wird nicht sehr böse sein! Du hast einen strengern Aufseher in dir, als selbst dein Vater ist! – Und so sind mehrere Züge in der Szene, aus der diese Stelle genommen ist. Der deutsche Ktesipho ist ein abgefeumter Bube, dem Lügen und Betrug sehr geläufig sind: der römische hingegen ist in der äußersten Verwirrung um einen kleinen Vorwand, durch den er seine Abwesenheit bei seinem Vater rechtfertigen könnte.
Rogabit me: ubi fuerim? quem ego hodie toto non vidi die.
Quid dicam?
Sy
. Nil ne in mentem venit?
Ct
. Nunquam quicquam.
Sy
. Tanto nequior.
Cliens, amicus, hospes, nemo est vobis?
Ct
. Sunt, quid postea?
Sy
. Hisce opera ut data sit.
Ct
. Quae non data sit? Non potest fieri!
Dieses naive, aufrichtige: quae non data sit! Der gute Jüngling sucht einen Vorwand; und der schalkische Knecht schlägt ihm eine Lüge vor. Eine Lüge! Nein, das geht nicht: non potest fieri!
{ ‡ }
Neun und neunzigstes Stück
Den 12ten April, 1768
Sonach hatte Terenz auch nicht nötig, uns seinen Ktesipho am Ende des Stücks beschämt, und durch die Beschämung auf dem Wege der Besserung zu zeigen. Wohl aber mußte dieses unser Verfasser tun. Nur fürchte ich, daß der Zuschauer die kriechende Reue, und die furchtsame Unterwerfung eines so leichtsinnigen Buben nicht für sehr aufrichtig halten kann. Eben so wenig, als die Gemütsänderung seines Vaters. Beider Umkehrung ist so wenig in ihrem Charakter gegründet, daß man das Bedürfnis des Dichters, sein Stück schließen zu müssen, und die Verlegenheit, es auf eine bessere Art zu schließen, ein wenig zu sehr darin empfindet. – Ich weiß überhaupt nicht, woher so viele komische Dichter die Regel genommen haben, daß der Böse notwendig am Ende des Stücks entweder bestraft werden, oder sich bessern müsse. In der Tragödie möchte diese Regel noch eher gelten; sie kann uns da mit dem Schicksale versöhnen, und Murren in Mitleid kehren. Aber in der Komödie, denke ich, hilft sie nicht allein nichts, sondern sie verdirbt vielmehr vieles. Wenigstens macht sie immer den Ausgang schielend, und kalt, und einförmig. Wenn die verschiednen Charaktere, welche ich in eine Handlung verbinde, nur diese Handlung zu Ende bringen, warum sollen sie
Weitere Kostenlose Bücher