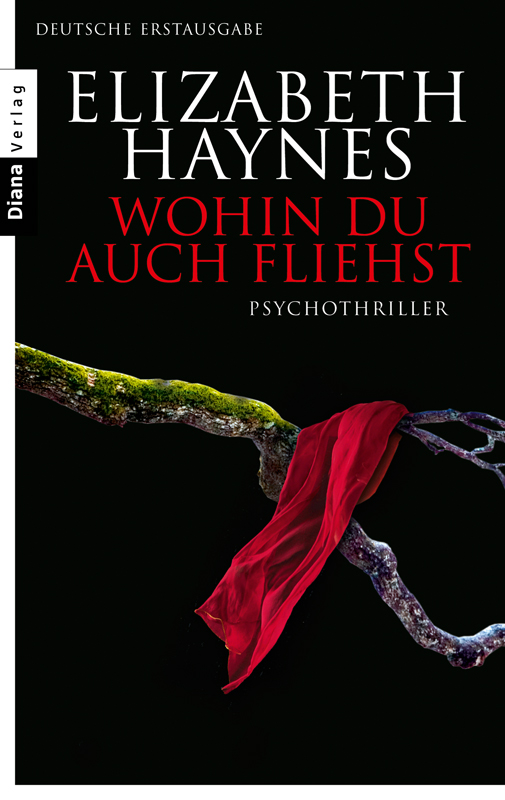![Wohin du auch fliehst - Thriller]()
Wohin du auch fliehst - Thriller
und schmeckte herrlich.
Als wir das Café verließen, lächelte ich immer noch. Die Sonne schien nur blass vom Himmel, tauchte aber alles in ein freundliches Licht. Wir gingen wieder zurück zum Pier.
Der Wind hatte ein wenig nachgelassen, doch am Wasser war es immer noch stürmisch. Wir setzten uns an eine geschützte Stelle, sahen den Wellen und den Möwen zu, die versuchten, auf dem Geländer zu balancieren. Draußen auf dem Meer waren die Wolken dunkel und riesig, hinter uns schien die Sonne und wurde von den glänzenden Brettern des Holzstegs reflektiert.
»Ein bisschen windig, was?«, sagte ein alter Mann. Er hatte sich die Mütze tief über die Ohren gezogen, ein paar graue Strähnen flatterten wild darunter hervor. Seine Brille war voller Meerwassertropfen.
»Nur ein bisschen«, pflichtete ich bei.
Er hielt seine Frau fest an der Hand. Ihre faltigen Hände waren voller Altersflecken, ihr Ehering war dünn geworden und saß locker hinter ihrem Fingerknöchel. Ihre Wangen waren rosig, sie hatte blaue Augen, ein gemustertes Tuch hielt ihre Haare zusammen und ihre Ohren warm. Sie kicherte und zeigte auf eine junge Möwe mit braunen Flecken und großen Schwimmfüßen, die vom Geländer geweht worden war und nun wie wild gegen den Wind anflatterte.
Wir liefen weiter. Die Fahrgeschäfte am Rummelplatz waren fast alle geschlossen, Planen flatterten im Wind, und die Sitze waren nass. Auf der anderen Seite des Piers entlangzulaufen wäre Wahnsinn gewesen – der Wind zerrte an unseren Jeans, die Gischt peitschte uns wie horizontaler Regen ins Gesicht. Über der tosenden Meeresoberfläche schwebte der Geist des West Pier, man konnte meinen, die Knochen eines längst verstorbenen Seeungeheuers würden angespült.
Wir gingen zurück zur Uferpromenade, betraten eine damp fende Pommesbude voller Menschen in feuchten Klamotten, die über den Wind lachten. Wir kauften uns eine große Tüte Pommes, setzten uns draußen auf eine Mauer, aßen sie mit den Fingern und lauschten auf das Kreischen der Möwen, die darauf warteten, dass wir ihnen etwas abgaben. Ich rechnete schon beinahe damit, dass mir eine die Pommes aus der Hand riss.
Ich hörte Stuart zu, der mir Geschichten von den Ausflügen ans Meer erzählte, die er als Kind unternommen hatte. Von Spielautomaten am Ende des Piers, von sonnenverbrannten Bei nen und Keschern an Bambusstangen.
»Was ist mit deinen Eltern?«, fragte ich.
»Meine Mutter starb an Krebs, als ich fünfzehn war«, sagte er. »Dad lebt in der Nähe von Rachel. Ihm geht es gut – aber er wird langsam alt. Ich habe ihn vor ein paar Monaten kurz gesehen. Nächsten Monat werde ich ihn besuchen, ich habe ein paar Tage frei.«
»Ist Rachel deine Schwester?«
»Ja, sie ist älter und sehr viel klüger. Was ist mit deiner Mom und deinem Dad?«
»Die sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als ich noch studierte.«
»Das muss heftig gewesen sein. Tut mir leid.«
Ich nickte.
»Keine Brüder oder Schwestern?«
»Nur ich.«
Wir hatten nur noch ein paar Pommes übrig, die harten am Tütenboden. Ungeachtet der Schilder, die das Füttern von Möwen verboten, schüttete sie Stuart auf den Boden und warf die Tüte in eine Mülltonne.
»Am liebsten würde ich jetzt Urlaub machen«, sagte er, als wir wieder den Hügel hinauf zum Zentrum gingen. »Lass uns ein paar Reiseprospekte besorgen.«
Freitag, 27. Februar 2004
Er brachte mich sofort mit dem Taxi nach Hause, was gut und schlecht zugleich war. Inzwischen wusste ich selbst gar nicht mehr, was ich eigentlich wollte.
Die gesamte Heimfahrt über sprachen wir kein Wort, obwohl er sanft, aber bestimmt meine Hand hielt. Ich starrte hinaus, ohne die am Fenster herunterlaufenden Regentropfen, die im Ampellicht wie orangefarbene Edelsteine glitzerten, richtig wahrzunehmen.
Er nahm meinen Hausschlüssel und schloss mir auf, machte einen Schritt zur Seite und ließ mich zuerst eintreten. Ich setzte mich nicht, genauso wenig wie er. Ich warf ihm einen flüchtigen Blick zu, und zu meiner Überraschung schien er so am Boden zerstört zu sein, dass ich ihn nicht noch mal ansehen konnte.
»Ich finde, wir sollten uns eine Auszeit gönnen«, sagte ich, und sobald ich das gesagt hatte, machte sich eine Welle der Erleichterung in mir breit.
»Wie bitte?«
»Ich sagte …«
»Ich habe gehört, was du gesagt hast. Trotzdem traue ich meinen Ohren kaum. Warum?«
»Ich habe einfach das Gefühl … Ich glaube, ich brauche ein wenig mehr Freiraum. Ich möchte
Weitere Kostenlose Bücher