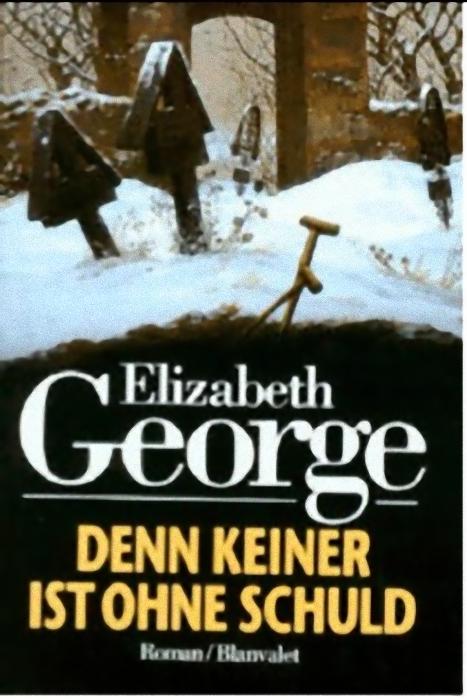![06 - Denn keiner ist ohne Schuld]()
06 - Denn keiner ist ohne Schuld
neue Gespräch und jede neue Tatsache lenkte ihre Gedanken in eine neue Richtung. Sie hatten keine konkreten Beweise, und soweit er sehen konnte, hatte es auch nie welche gegeben, es sei denn, irgend jemand hatte sie entfernt. Keine Waffe am Tatort, kein belastender Fingerabdruck, kein Härchen. Die einzige Verbindung, die sich zwischen der angeblichen Mörderin und ihrem Opfer herstellen ließ, waren ein Telefongespräch, das Maggie mitgehört und Polly bestätigt hatte, und ein Abendessen, nach dem beide Personen, die davon gegessen hatten, erkrankt waren.
Lynley war sich im klaren darüber, daß er und St. James dabei waren, aus dünnsten Fädchen ein Gewebe der Schuld zu flechten. Er fühlte sich nicht wohl dabei. Und ihm war auch nicht wohl angesichts des versteckten Interesses und der Neugier von Polly Yarkin, die sich anscheinend unbeteiligt in dem Raum zu schaffen machte.
»Waren Sie bei der Leichenschau?« fragte er sie.
Sie zog den Arm von der Lampe weg, als fühlte sie sich bei einem Vergehen ertappt. »Ich? Ja. Alle waren dort.«
»Warum? Hatten Sie eine Aussage zu machen?«
»Nein.«
»Aber...?«
»Nur... ich wollte einfach wissen, was passiert. Ich wollte es hören.«
»Was denn?«
Sie hob leicht die Schultern und ließ sie wieder herabfallen. »Was sie zu sagen hatte. Nachdem ich erfahren hatte, daß der Pfarrer an dem Abend bei ihr gewesen war. Alle sind hingegangen«, wiederholte sie.
»Weil es sich um den Pfarrer handelte? Und eine Frau? Oder um diese besondere Frau, Juliet Spence?«
»Weiß ich nicht«, antwortete sie.
»Was alle anderen betrifft? Oder was Sie selbst betrifft?«
Sie senkte den Blick. Das reichte aus, um ihm zu verraten, warum sie ihnen den Tee gebracht hatte und warum sie, nachdem sie ihn eingeschenkt hatte, im Arbeitszimmer geblieben war.
21
Als Polly die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, gingen St. James und Lynley die Einfahrt hinunter. An ihrem Ende blieb Lynley stehen und richtete seine Aufmerksamkeit auf die Silhouette der Johanneskirche. Es war mittlerweile ganz dunkel geworden. An der Straße, die leicht ansteigend durch das Dorf führte, brannten schon die Laternen. Hier bei der Kirche jedoch, außerhalb des eigentlichen Dorfs, spendeten nur der Vollmond - der jetzt über dem Gipfel des Cotes Fell aufstieg - und die Sterne, die ihn begleiteten, Licht.
»Ich könnte eine Zigarette gebrauchen«, sagte Lynley zerstreut. »Was meinst du, wann dieses Bedürfnis, mir eine anzuzünden, endlich aufhören wird?«
»Wahrscheinlich nie.«
»Na, das ist wirklich tröstlich.«
»Es ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, die auf wissenschaftlichen und medizinischen Erfahrungen beruht. Tabak ist eine Droge. Man wird die Sucht niemals ganz los.«
»Und wie bist du ihr entronnen? Ich weiß noch, wie wir nach dem Sport immer heimlich gepafft haben. Kaum waren wir über die Brücke in Windsor, haben wir uns eine ins Gesicht gesteckt und uns selbst mit unserer Lässigkeit mächtig imponiert. Nicht zu vergessen, daß wir natürlich auch allen anderen unbedingt imponieren wollten. Warum ging dir das nicht so?«
»Ich nehme an, weil ich in ziemlich zartem Alter einer Schocktherapie ausgesetzt worden bin.«
Als Lynley ihm einen fragenden Blick zuwarf, fuhr St. James fort: »Meine Mutter erwischte David mit einer Packung Dunhill, als er zwölf war. Sie sperrte ihn in die Toilette ein und zwang ihn, die Zigaretten alle zu rauchen. Uns andere hat sie gleich mit ihm eingesperrt.«
»Solltet ihr auch rauchen?«
»Nein, zusehen. Meine Mutter hat von Anschauungsunterricht immer viel gehalten.«
»Und er hat ja auch gewirkt.«
»Bei mir, ja. Und bei Andrew auch. Aber für Sid und David hat die Genugtuung, Mutter ärgern zu können, immer alle Scherereien, die sie dadurch hatten, mehr als wettgemacht. Sid hat geraucht wie ein Schlot, bis sie dreiundzwanzig war. David tut es immer noch.«
»Aber deine Mutter hatte recht. Mit dem Tabak.«
»Natürlich. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ihre Erziehungsmethoden gerade das Richtige waren. Wenn wir es zu weit getrieben haben, konnte sie wirklich fuchsteufelswild werden. Sidney behauptete immer, das läge an ihrem Namen: Was kann man sonst von einer Frau erwarten, die Hortense heißt, fragte Sidney immer, wenn wir mal wieder für dies oder jenes verdroschen worden waren. Ich glaube hingegen, für sie war das Muttersein eher ein Fluch als ein Segen. Mein Vater war ja fast nie zu Hause. Sie mußte allein fertig werden, unterstützt
Weitere Kostenlose Bücher