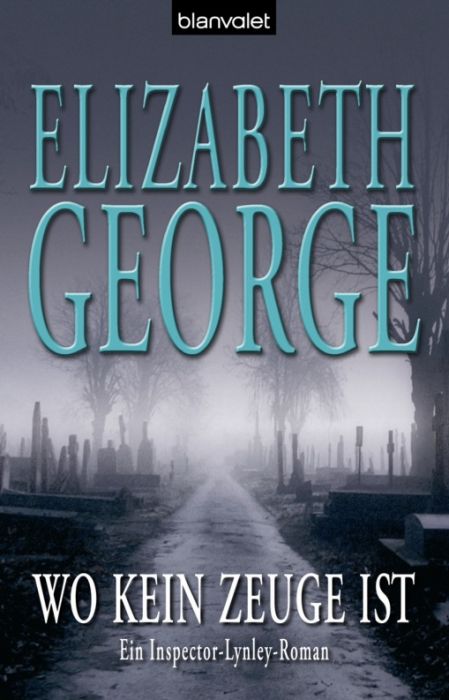![13 - Wo kein Zeuge ist]()
13 - Wo kein Zeuge ist
befördert hatte. Aber es war etwas völlig anderes, sich eingestehen zu müssen, dass Winston - egal, ob Opfer politischer Manipulation oder nicht - seine neue Position verdient hatte. Was alles noch schlimmer machte, war, dass sie trotz dieser Erkenntnis mit ihm zusammenarbeiten musste, wobei sie genau merkte, dass ihm das Ganze ebenso zu schaffen machte wie ihr.
Wäre Winston blasiert gewesen, hätte sie gewusst, wie sie damit umgehen musste. Wäre er ihr arrogant gekommen, hätte sie sich einen Spaß daraus gemacht, ihn zu ärgern. Wäre er ostentativ bescheiden aufgetreten, hätte sie ihn mit ihrer scharfen Zunge angemessen zurechtgestutzt. Aber er war nichts von alldem, nur eine stillere Version des normalen Winston, eine Version, die bestätigte, was Lynley gesagt hatte: Winnie ließ sich von niemandem Sand in die Augen streuen. Er wusste ganz genau, was Hillier und das Pressebüro abziehen wollten.
Letztlich war es also Mitgefühl, das Barbara für ihren Kollegen empfand, und das hatte sie bewogen, ihm eine Tasse Tee mitzubringen, als sie sich selbst eine holte, und ihm mit den Worten zu überreichen: »Glückwunsch zur Beförderung, Winnie.« Sie stellte die Tasse auf seinen Schreibtisch.
Zusammen mit den Constables, die DI Stewart dafür eingeteilt hatte, war Barbara zwei Tage und zwei Abende damit beschäftigt gewesen, die überwältigende Zahl von Vermisstenanzeigen durchzuackern, die sie aus dem SO5-Computer gezogen hatte. Schließlich war Nkata mit eingestiegen. Sie hatten eine beträchtliche Anzahl von Namen von der Liste streichen können: Kinder, die wieder nach Hause gekommen waren oder Kontakt zu ihren Familien aufgenommen und ihren Aufenthaltsort mitgeteilt hatten. Wie erwartet, befanden sich einige der Vermissten in Jugendhaft, andere in Heimen. Aber es blieben immer noch Hunderte von vermissten Jugendlichen übrig, und die Detectives begannen schließlich, ihre Beschreibungen mit denen der unidentifizierten Leichen zu vergleichen. Teilweise ließ sich das per Computer erledigen. Zum Teil war es aber auch Handarbeit.
Sie hatten die Fotos und Autopsieberichte der ersten drei Opfer als Ausgangspunkt, und in fast allen Fällen waren die Eltern oder Vormunde der vermissten Jugendlichen kooperativ. Zu guter Letzt hatten sie sogar eine mögliche Identifizierung zustande gebracht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der fragliche vermisste Junge wirklich eines der Opfer war, war gering.
Dreizehn Jahre alt, halb schwarz, halb philippinisch, Kopfhaar rasiert, Nase an der Spitze abgeflacht und an der Wurzel gebrochen. Sein Name war Jared Salvatore, abgängig seit zwei Monaten und von seinem älteren Bruder vermisst gemeldet, der - so stand es in den Akten - den Anruf bei der Polizei vom Pentonville-Gefängnis aus getätigt hatte, wo er wegen eines bewaffneten Raubüberfalles einsaß. Woher der große Bruder wusste, dass Jared vermisst wurde, stand nicht in dem Bericht.
Aber das war alles. Aus der unüberschaubaren Zahl vermisster Jugendlicher Identifizierungen der Leichen zu ermöglichen war ungefähr so, als suche man Fliegenscheiße im Pfeffer, solange es ihnen nicht gelang, eine Verbindung zwischen den Opfern zu erkennen. Und bedachte man, wie weit die Fundorte auseinander lagen, war eine solche Verbindung unwahrscheinlich.
Als Barbara genug gearbeitet hatte - oder zumindest so viel, wie sie an einem Tag verkraften konnte -, hatte sie zu Nkata gesagt: »Ich verschwinde, Winnie. Bleibst du noch, oder was?«
Nkata hatte seinen Stuhl zurückgerollt, sich den Nacken massiert und geantwortet: »Ich bleib noch ein bisschen.«
Sie nickte, ging aber nicht sofort. Sie hatte das Gefühl, dass sie beide etwas sagen mussten, war aber nicht sicher, was. Nkata war derjenige, der den ersten Schritt machte.
»Was machen wir denn jetzt, Barb?« Er legte seinen Kuli auf den Notizblock. »Die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Wir können ja nicht so tun, als wär nichts.«
Barbara setzte sich wieder hin. Auf dem Schreibtisch stand ein magnetischer Büroklammerspender, und sie nahm ihn in die Hand und spielte damit. »Ich denke, wir tun einfach, was getan werden muss. Ich schätze, der Rest findet sich schon irgendwie.«
Er nickte versonnen. »Ich fühl mich nicht besonders wohl in meiner Haut. Ich weiß, warum ich hier bin, und ich will, dass du das verstehst.«
»Schon klar«, erwiderte Barbara. »Aber sei nicht unfair zu dir selbst. Du hast verdient ...«
»Hillier hat keinen blassen Schimmer, was ich
Weitere Kostenlose Bücher