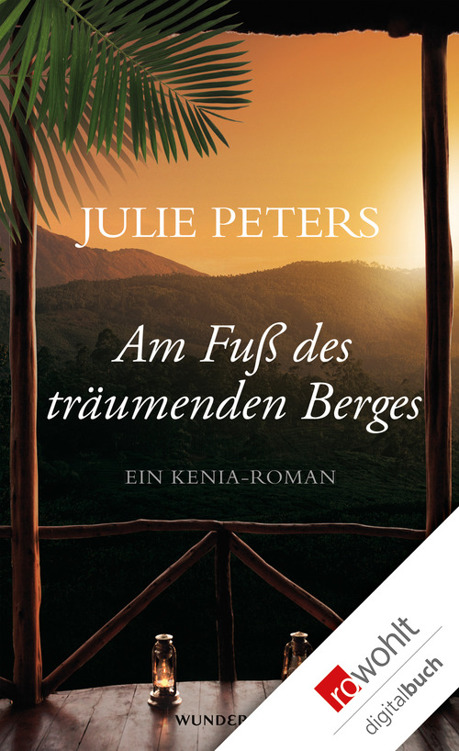![Am Fuß des träumenden Berges]()
Am Fuß des träumenden Berges
Das wusste er vom Bwana.
«Es geht auch nicht. Der Suezkanal ist gesperrt, und es fahren keine Schiffe mehr. Nur noch Truppentransporter, so nennen sie die Schiffe für die Soldaten. Und Matthew sagt, es sei zu gefährlich.» Sie schwieg einen Moment, dann fügte sie leise hinzu: «Ich wäre jetzt gern bei meiner Mutter.»
Er blieb sitzen und schwieg. Die Memsahib wiegte das Kind, und im Haus war das Trappeln nackter Füße zu hören, weil der kleine Junge in die Küche lief. Er kam mit einem Teller zurück, auf dem zwei Scheiben Brot mit Butter und Honig lagen. Chris setzte sich neben Kinyua und bot ihm von den Broten an. Er nickte, wählte das kleinere und aß es langsam. Der Honig war süß, die Butter darunter leicht gesalzen.
«Wann hast du gelernt, so gut unsere Sprache zu sprechen?», fragte die Memsahib.
«Dein Mann hat es mir beigebracht. Und seine Missionare. Sie mussten uns ihre Sprache lehren, um uns von eurem Gott zu erzählen.»
«Und gefällt dir, was sie über unseren Gott erzählt haben?»
Kinyua dachte lange darüber nach. Er wusste, es machte der Memsahib nichts aus, wenn er lange schwieg. Sie wiegte den kleinen Kerl in ihrem Schoß und summte leise. Eine friedliche Stimmung, ganz anders als bei ihm im Dorf, wo die Weiber sich ständig ankeiften.
«Ich verstehe euren Gott nicht», sagte er schließlich. «Eure Missionare sagen, er tue das alles, was er tut, aus einem bestimmten Grund. Wieso dann dieser Krieg? Und ergreift er in diesem Krieg für eine Seite Partei? Oder wird er einfach zusehen und nichts tun?»
«Was würde dein Gott denn tun?»
Kinyua schüttelte den Kopf. «Solche Fragen stellen wir uns gar nicht. Was Ngai auch tut, ist gut und richtig. Er ist nicht mehr für die Kikuyu Gott oder mehr für die Massai oder die Luo. Und er hat keine Gründe. Er ist. Das genügt uns.»
«Siehst du … wir Weißen glauben, es muss immer für alles einen Grund geben, ein Ziel und eine Erkenntnis aus dem, was geschieht.»
«Dann beantwortet das deine Frage. Ngai, wie ich ihn kenne – und nicht euer Gott – ist der wahrhaft richtige Gott.»
Sie stritt nicht mit ihm, sondern lächelte nur. Chris hatte sein Brot aufgegessen. Er sprang auf und trug den Teller zurück ins Haus.
«Sie werden so schnell groß …», hörte er die Memsahib seufzen.
«Keine Angst», sagte er. «In diesem Krieg muss er nicht kämpfen. Er wird überleben.»
[zur Inhaltsübersicht]
21 . Kapitel
Ein kalter Schauer überkam Audrey, als Kinyua das sagte.
Er wird überleben …
Es war ihre größte Angst, ihrem Kind könnte irgendwas zustoßen. Aber sie machte sich nicht mehr nur Sorgen um Chris und Thomas, sondern auch um Matthew, der spätestens übermorgen nach Nairobi aufbrechen wollte. Von dort in den Süden, zur Grenze nach Tanganjika. Dorthin, wo auch Benjamin stationiert war – auf der anderen Seite der Grenze.
Diese beiden Männer, vereint in ihrem Kampf. Aber auf gegnerischen Seiten.
Mein Sohn wird leben …
Chris saß dicht neben dem Kikuyu. Er kannte keine Scheu vor den Schwarzen. Wenn sie ihn ließe, würde er jeden Tag durch den Wald streifen und zum Dorf laufen oder durch den Garten zu den Hütten, um dort mit den anderen Kindern zu spielen. Dort war er der Außenseiter mit seiner weißen Haut, aber die anderen Kinder schlossen ihn nicht aus von ihrem Spiel, sondern erhoben ihn zu ihrem König, womit sie unwillkürlich das nachahmten, was in der Welt der Erwachsenen bereits Realität war. Sie flochten einen Hocker aus Schilfgras und setzten Chris darauf, und dann trugen sie ihn durch das Dorf und sangen ihre Lieder.
Audrey konnte den Kindern ihr Spiel nicht verbieten, doch sie überkam immer ein ungutes Gefühl, wenn sie sie dabei beobachtete.
Und nun war sie bald ganz allein auf der Farm. Nicht mal Fanny konnte sie unterstützen. Die Freundin war bei einem ihrer Besuche in Nairobi vom Kriegsausbruch überrascht worden, und sie hatte geschrieben, es gehe in der Stadt einfach gruselig zu. Frauen und Kinder aus dem Umland wurden in die Stadt geholt, weil man behauptete, dort sei es für sie sicherer. Weil aber die Stadt zu klein war für so viele Menschen, wurden am Stadtrand in aller Hast Baracken errichtet und Zelte für die Siedlerfrauen, in denen sie hausten wie im Wilden Westen. Fanny war bei den Tuttlingtons untergekommen, die in ihrem Stadthaus etwa zwanzig Frauen Unterschlupf boten. «Für dich ist hier auch ein Plätzchen», schrieb Fanny. Doch Audrey wusste, dass die Flucht in die
Weitere Kostenlose Bücher