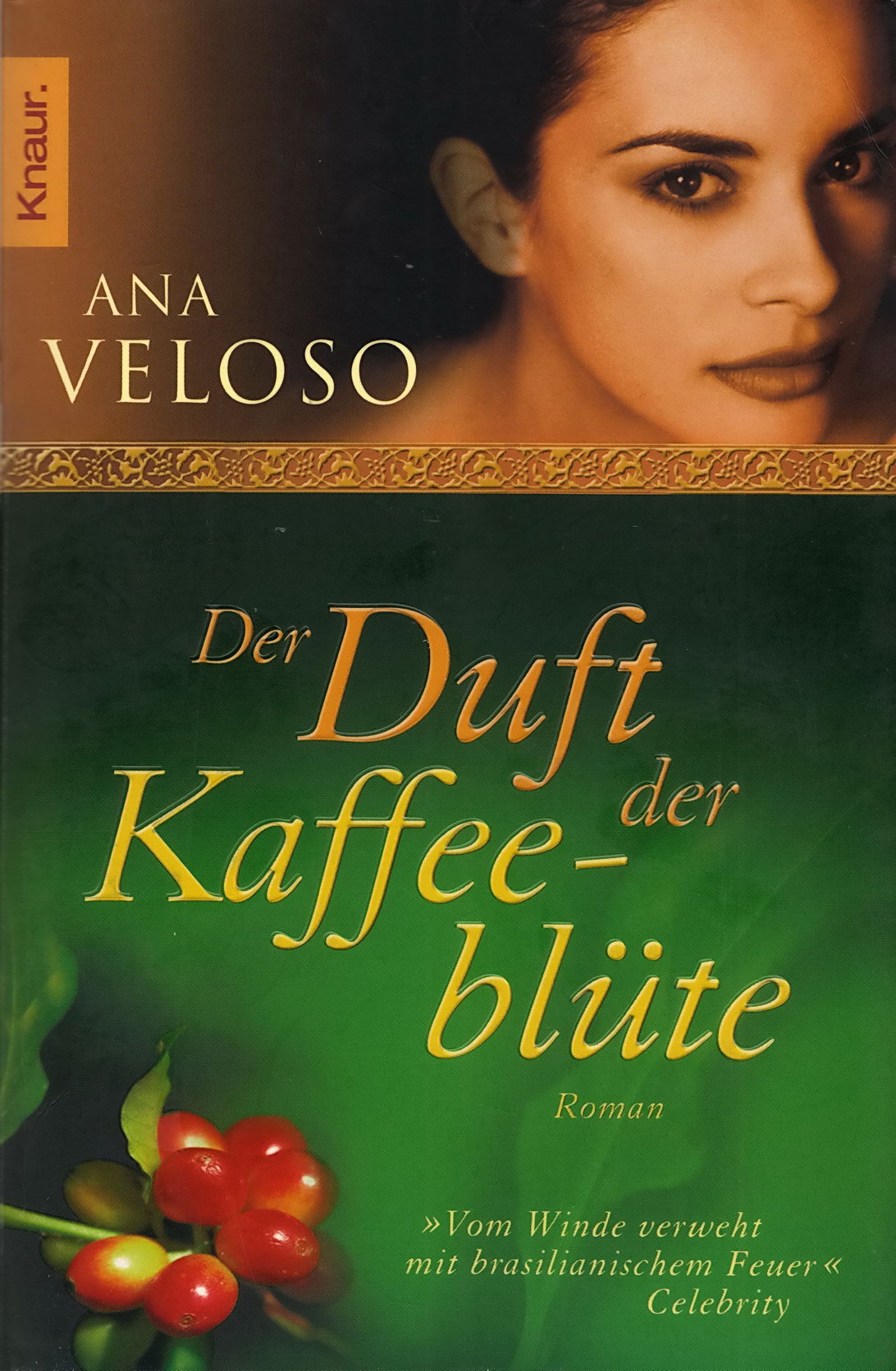![Ana Veloso]()
Ana Veloso
saßen beide im Speisesaal und warteten auf ihre Tochter,
die ausnahmsweise die Letzte war, weil sie sich von der Kaffeeblüte zum Träumen
hatte hinreißen lassen.
»Sag meinen Eltern, dass ich schon unterwegs
bin.«
»Sehr wohl, Sinhá Vitória.« Miranda knickste
ungelenk, drehte sich um und schlug hinter sich die Tür zu.
»Himmel!« Ungehalten zog Vitória die Brokat-Vorhänge
zu, warf sich ihren mit echten Brüsseler Spitzen besetzten Morgenmantel über
und blickte in den Spiegel auf ihrem Frisiertisch. Mit geübtem Griff flocht sie
ihr Haar zu einem Zopf, der ihr fast bis zur Taille reichte, um diesen dann zu
einem sittsamen Knoten im Nacken zu drehen. Dann schlüpfte sie in ihre
Hausschuhe und machte sich auf den Weg zum Speisezimmer.
Alma und Eduardo da Silva erwarteten sie mit
vorwurfsvollen Blicken.
»Vitória, mein Kind.« Mit belegter Stimme begrüßte
Dona Alma ihre Tochter. Vitória ging zu ihr und drückte ihr einen Kuss auf die
Stirn.
»Mamãe, wie geht es Ihnen heute Morgen?«
»Unverändert, Liebes. Aber nun lass uns beten,
damit dein Vater endlich essen kann. Er hat es eilig, wie du weißt.«
»Papai, es tut mir ...«
»Seht! Später.«
Dona Alma hatte die Hände bereits gefaltet und
murmelte ein kurzes Morgengebet. Mit den dunklen Ringen unter den Augen, den
knotigen, rheumatischen Fingern und dem streng zurückgebundenen Haar, das
bereits von zahlreichen grauen Strähnen durchzogen war, sah sie aus wie eine
Greisin. Dabei war Alma da Silva erst 42 Jahre alt, ein Alter, in dem diverse
andere Damen der Gesellschaft immerhin noch tanzten und den Ehemännern ihrer
Freundinnen schöne Augen machten. Und so peinlich deren Auftritte auch sein
mochten – manchmal wünschte sich Vitória, ihre Mutter sei ebenfalls so lebenslustig
und ein bisschen weniger märtyrerhaft. »Amen«, beendete Eduardo da Silva
ungeduldig das Gebet, kaum dass seine Frau den letzten Vers aufgesagt hatte.
»So, liebe Vita, jetzt darfst du dich
entschuldigen, wenn es das ist, was du vorhin sagen wolltest.« Ihr Vater biss
herzhaft in seine torrada, auf die er einen ungehörigen Berg von Frischkäse
und Guavengelee getürmt hatte. Aber sowohl seine Frau als auch seine Tochter
sahen es ihm nach. Eduardo da Silva stand jeden Tag um vier Uhr in der Früh
auf, arbeitete zwei Stunden an seinem Schreibtisch, um sich schließlich bei
Sonnenaufgang seinen anderen Pflichten als Fazendeiro zu widmen. Er inspizierte
die Ställe und die senzalas, die Sklavenunterkünfte, ritt über die
Felder und begutachtete die Kaffeesträucher, gab dem Vorarbeiter Anweisungen für
den Tag und hatte immer noch ein freundliches Wort für den Schmied oder die
Melkerin übrig. Gegen acht Uhr kam er zurück zum Herrenhaus, um gemeinsam mit
seiner Frau und seiner Tochter zu frühstücken – ein Ritual, das ihm heilig war.
Kein Wunder, dass er dann ausgehungert war und zuweilen gegen die Tischsitten
verstieß.
Jetzt wischte er sich die Krümel aus seinem
Vollbart, der ähnlich eindrucksvoll war wie der des Kaisers.
»Papai, entschuldigen Sie. Ich hatte tatsächlich
ganz vergessen, dass Sie heute nach Vassouras müssen. Aber haben Sie nicht
gesehen: Der Kaffee blüht. Ist es nicht herrlich?«
»Ja, ja, die Ernte verspricht wirklich gut zu
werden. Ich hoffe nur, dass Senhor Afonso heute Morgen nicht dasselbe gedacht
hat und wieder einen Rückzieher macht.«
»Das wird er nicht, Papai. Keine noch so reiche
Ernte kann ihn mehr retten. Diesmal wird er verkaufen.«
»Dein Wort in Gottes Ohr, Vita. Aber bei Afonso
weiß man nie. Der Mann ist verrückt und unberechenbar. Würdest du mir bitte die
Brioches reichen?«
Der Korb mit dem Gebäck stand direkt vor Dona
Alma, die ihrer Tochter zuvorkommen wollte. Doch als sie danach griff, hielt
sie mitten in der Bewegung inne und verzog das Gesicht vor Schmerz. »Mamãe? Ist
es wieder schlimmer geworden?«
»Die Schmerzen sind einfach grauenhaft. Aber
macht euch um mich keine Gedanken, ich werde nach Doutor Vieira schicken. Sein
Schmerzmittel hat beim letzten Anfall Wunder gewirkt. Wirst du Félix heute
entbehren können?«, fragte sie ihren Mann. Félix war auf Boavista der Junge für
alles. Er war vierzehn Jahre alt, hoch gewachsen und von kräftiger Statur. Doch
bei der Ernte konnte er nicht eingesetzt werden: Er war stumm, und den Hänseleien
der Feldsklaven konnte er nur mit seinen Fäusten begegnen. Nach ein paar Wochen
auf den Feldern, von denen Félix allabendlich mit schlimmen Blessuren
Weitere Kostenlose Bücher